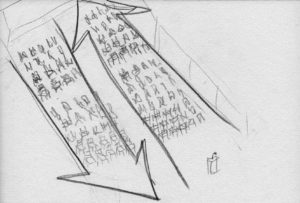FALLHÖHE. Zeitgenössische Performancepraxis und Wissensgenerierung in Performance Art
Von Elke Mark
Nach Workshops und Pause rückt der Zeitpunkt des Vortrags näher, sodass ich zügig die Vorbereitungen für die räumliche Umstrukturierung des Vortragssaales aufnehme. Die Hälfte der Bestuhlung des Raumes wird um 180° gedreht. Die hereinströmenden Zuhörer*innen haben die Wahl, sich auf einem Stuhl auf der nach vorn ausgerichteten Seite des Raums niederzulassen oder einen Stuhl mit Blick in Richtung des hinteren Teils des Raumes zu wählen.
Die schwarzen Vorhänge des Raumes werden aufgezogen und geben den Blick auf das – aufgrund der Hitze erwartete – aktuell tobende Gewitter frei.
Im vorderen Teil des Raumes steht ein Spiegel. Nachdem alle Platz genommen haben, trete ich am Ende des Raumes an das bereitgestellte Mikrofon und beginne zu sprechen.
Performance Art polarisiert. Performances können langweilen, Unverständnis hervorrufen, provozieren. Im seltensten und schlechtesten Fall lässt das Gezeigte unberührt. Im besten Falle jedoch reicht Performance Art über alle Vorbehalte hinweg, wirkt distanzlos in unsere Lebenswirklichkeit hinein, rührt an unseren elementaren menschlichen Bedürfnissen, berührt Sinnfragen des Daseins und klammert tagtägliche Erfahrungen von Widersprüchlichkeit nicht aus.
In die Debatte um künstlerische Forschung hat seit einigen Jahren eine neue Perspektive auf Kriterien eines zeitgemäßen, wissenschaftlichen Erkenntnisbegriffs Einzug gehalten, die sich nicht mehr allein im Interesse an künstlerischer Expertise als Ergänzung oder Illustrierung aktueller wissenschaftlicher Verfahren erschöpft, sondern das Erkenntnispotenzial der Kunst selbst – und darin insbesondere performative Verfahren zur Wissensgenerierung – in den Vordergrund rückt.1
Der Kunst einen Eigenwert als „genuin epistemische Praxis“ zuzugestehen heißt, die individuelle, unerwartete, einmalige künstlerische Erfahrung in den Mittelpunkt der Erkenntnisgenerierung zu stellen (vgl. Klein 2010). Elke Bippus betont: „Denn Künstlerische Forschung fügt sich nicht den Kriterien der beweisführenden Wiederholbarkeit, der Rationalität und Universalisierbarkeit. Sie operiert im Singulären und muss folglich anhand je konkreter Beispiele exemplifiziert werden“ (Bippus 2009/12: 10). Künstlerische Forschung könne „ein »implizites Wissen«, Brüche und Ungeklärtes fruchtbar machen“ und fordere damit neue Formen der Kommunizierbarkeit in der konventionellen Wissenschaftspraxis heraus (ebd.: 13).
Performance Art als performative künstlerische Forschung verschiebt den Fokus damit erneut auf den Prozess der Herausbildung eines Wissens, statt das Ansammeln von Informationswissen voran zu treiben. In einem auf Handlung und Verkörperung ausgerichtetem Forschen kommt dem Ereignis ein besonderer Stellenwert zu. Denn im Unterschied zur wissenschaftlichen Praxis zeigt eine solche künstlerische Praxis ihr Wissen und lädt ein, „Wissensbildung in ihrer Dynamik, im Modus der Unbestimmtheit und Mehrdeutigkeit als Gewinn zu begreifen“ (ebd.: 18). Bippus führt hierzu aus: „Mit dem performative turn, der tradierte Methoden revidiert hat und Erfahrung durch Kunst und das Ästhetische einbezieht, entsteht eine Wissenskultur, in der Wissen als Handlung und Prozess erfahrbar wird“ (ebd.). Kunst biete weniger Forschungsergebnisse, also „kein allgemeines, abrufbares und intersubjektiv verifizierbares Wissen“ an, sondern vielmehr sich selbst als Instrument, um in eine „denkende Begegnung“ einzutreten und „in einer solchen dialogischen Auseinandersetzung […] zu einem Feld der Alternativen, der Entwürfe und Modelle [zu] werden, zu einem Begegnungsfeld zwischen verschiedenen Wahrnehmungs- und Denkmodi, zwischen unterschiedlichen Positionen und Subjektivitäten“ (ebd.: 17).
Auch Dieter Mersch kristallisiert drei konstituierende Merkmale für wissenschaftliche Erkenntnis heraus, deren fortdauernden Gültigkeitsanspruch er zugleich in Frage stellt: das Prinzip der Identität im Sinne der Wiederholbarkeit der Bestimmung von „etwas »als« etwas“, Universalisierbarkeit und logisch begründete Kausalität (vgl. Mersch 2009: 31). Alternativ verweist er auf Wissensformen, die sich durch „experimentelle Reflexivität“ auszeichnen und deren Besonderheit durch den ästhetischen Vollzug charakterisiert sei, „der auf Wahrnehmungen und nicht auf argumentative Bestimmungen oder Diskurse referiert“, insofern „im Sinnlichen und nicht im Begrifflichen operiert“ und an Singularität und Einzigartigkeit von Wahrnehmungen geknüpft sei (ebd.: 37). Als »ästhetische Argumente« experimenteller Reflexivität führt er Konjunktion – als eine gleichermaßen trennende wie verbindende Praxis – und situative Intervention – als eine kontrastierende, herausfordernde Praxis – ein, denen er einen gleichberechtigten Status gegenüber diskursiven Argumentationen beimisst. Mersch betont: „Die künstlerische Praxis bezieht ihre Riskanz und Prekarität aus dieser Anstrengung einer ebenso weg- wie ziellosen Probe im Singulären, wie sie beispielsweise in der fortgesetzten Praktik der Trennung und Verbindung disparater Materialien, der Unterbrechung medialer Strukturen, der überraschenden Kontrastierung und Kombination von Perspektiven, der graphischen Verzerrung, der Suche nach dem Abstrakten im Konkreten, der Gestaltung an den Grenzen der Wahrnehmbarkeit oder ähnlichem ihren Niederschlag findet“ (ebd.: 38).
Ohne Forderung nach Allgemeingültigkeit und nach Fundierung in Begriffen widmen sich demnach Künstler*innen in ihrer Forschung dem grundlos Sich-Ereignenden, dem Undarstellbaren, Ausgeschlossenen oder Übriggebliebenen. Diese Differenzierungspraktiken konstituieren künstlerische Erkenntnispraxen, die nach Mersch der wissenschaftlichen wie der philosophischen als ebenbürtig, wenn nicht sogar in ihrem zeigenden Modus in mancher Hinsicht als überlegen erachtet werden können (vgl. ebd.: 40).
In Bezug zur Diskussion um Wirksamkeiten in der Performance Art möchte ich den Blick auf die Ressourcen unseres Körpers lenken und unser Wissen über den Körper ergänzen um ein feines Gespür für die eigenen Wahrnehmungsprozesse, die uns zu Expert*innen für unsere Körper machen. Denn die als Taktiles Wissen beschreibbare individuell-körperliche, taktil-kinästhetische Wahrnehmungsebene nimmt die durch komplexe, haptische Erfahrungen entstandene Vorerfahrung in Kombination mit unbewusster Wahrnehmung ernst, die im Wechselspiel mit Affizierung im Kontakt, in Kommunikation und Bewegung die Grundlage unserer Denkprozesse bildet (vgl. hierzu auch Liechti 2000 und Mark 2012). Wir erfahren künstlerische Performances körperlich, nehmen das Gezeigte sinnlich „weder als kontinuierliches Nacheinander noch als präsentisches Nebeneinander, sondern als prozessuale Spannung zwischen Simultanem, Sukzessivem und Körperlich-Räumlichem“ (Gronau et al. 2007: 25) wahr. In Performance Art als forschender Körperpraxis, der ich einen eigenständigen Beitrag zu Erkenntnisgewinnung in eigener Gestalt zugestehe, kommt das Körperliche selbst „zu Wort“. Doch bleiben wir noch einen Moment bei der Frage, was geschieht, wenn Performance Art Wirkung zeigt.
Setzen wir uns einer Performance aus, spüren wir sehr schnell, ob das Gezeigte unsere Zustimmung findet, in Belanglosigkeit versinkt oder Widerstand hervorruft. Noch bevor wir es wissen, hat sich längst entschieden, ob ein Gedanke oder ein Bild weitere Aufmerksamkeit erhält und wir dem Impuls und seiner Ausdehnung folgen. Bis etwas von der inneren Bewegung sich im Außen zeigt und wir selbst in Bewegung geraten, hat diese Anrührung schon viele Wege genommen. Wurde vielleicht schon von einem Umstehenden registriert, aufgenommen und beantwortet. Dies spielt sich innerhalb kürzester Zeit ab.
Im folgenden Versuch, die Zeit etwas zu dehnen, um in der Beschreibung dessen, was geschieht, genauer werden zu können, nehmen wir Platz am Tisch eines Treffens der TAFELRUNDE, eines seit März 2014 monatlich in Flensburg stattfindenden offenen Treffens (Performance-)Kunstinteressierter, das sich als Ort interdisziplinärer Begegnung und als Plattform experimentellen Denkens und Dialogs versteht. Bei gemeinsamem Essen und Gespräch entfaltet sich, über die Idee des performativen Mit-Teilens, Raum für noch Ungedachtes, dessen Impulsen und Wirkungen nachgespürt wird.
Während des Essens und Sammelns von Fragen und Gedanken zum Rahmenthema „EINS“ aus der Runde steht eine Besucherin auf, um ihren Beitrag vorzustellen:
„eins“ – sagt sie leise und zeigt mit dem rechten Finger in die Höhe, sie lässt die Hand wieder sinken, macht eine kurze Pause. „eins“ spricht sie erneut, wiederholt das Wort und die Geste, mehrfach, wobei sich allmählich ein betonendes, deutliches Stampfen mit dem rechten Fuß hinzugesellt. Sie variiert Tonfall und Lautstärke, hält schließlich die Hand auf Augenhöhe, um – plötzlich – nach Aussprechen der „eins“ eine „zwei“ zu ergänzen. „eins, zwei“ wiederholt sie, den Blick langsam von einer auf die andere Hand richtend. Dies wiederholend, stellt sich parallel zum Gesagten zunächst eine zarte Kopfwendung, dann eine seitlich schaukelnde Bewegung des Körpers ein, die – zunehmend rhythmischer – in ein abwechselndes Bewegen des mittlerweile gestreckten rechten und linken Armes übergeht und im weiteren Verlauf, dabei stets lauter skandierend, schließlich die Bewegung beider Beine einbeziehend, in einen spannungsgeladenen, energischen Marsch mündet – um sich völlig unvermittelt „eins, zwei“ – „drei“ in den wiegenden Tonfall eines Walzertaktes aufzulösen, der in einen beschwingten Tanz übergeht „eins, zwei, drei. eins, zwei, drei“. Sich tanzend drehend bleibt die Erwartung der „vier“ offen …
In dieser kurzen Performance ereignet sich etwas. Bewegungen, Übergänge, Rhythmus, Stimme, Körper, Zeit und Raum bilden in einer bestechenden Folgerichtigkeit und in der Gleichzeitigkeit der sinnlichen Eindrücke eine seltsam geheimnisvolle Einheit im Körper der Performerin, die sich sichtbar in die Körper aller Beteiligten verlängert.
Man muss nicht musikalisch sein, um die Eigenheiten und Qualitäten der wechselnden Takte zu erfassen, die sich im rhythmischen Taktklopfen und Mitnicken der Zuschauenden spiegeln. Es entfaltet sich ein Raum, in dem die jeweiligen Rhythmen, auch nachdem sie verklungen sind, widerhallen. Der hier beschriebene Akt folgt einer Eigenlogik performativer Handlung. Von der visuellen Anschauung ausgehend, um Sound, atmosphärische Stimmung und Bewegung ergänzt, zudem zahlreiche Assoziationen wachrufend und Verbindungen mit Erinnertem eingehend, entsteht ein komplexes, multimodales Wahrnehmungsangebot, das Zugang zu einem Reichtum an Wissen eröffnet, das sich in unseren Körpern verbirgt. Ein Wissen, das sich aus Bewegungen und dem Reservoir unbewusster Wahrnehmungen speist und sprachlich kaum zugänglich ist. Wo das Gesprochene Grenzen erreicht und sich in Wiederholungen zu erschöpfen droht, vermag die Umsetzung eines Gedankenimpulses in eine gezeigte Handlung in ihrer Differenz, Ambivalenz und Uneindeutigkeit, neue Anknüpfungspunkte anzubieten, die wir verwundert zur Kenntnis nehmen und als Impuls zum Perspektivwechsel aufgreifen.
Rhythmus im Sinne von Bewegung, Veränderlichkeit und Flüchtigkeit, als „Zusammenspiel von Erinnerung, Erfahrung, Erleben, Wiedererkennen und Antizipation von Erwartetem“ (Gronau et al. 2007: 28) kann also als dem Körper eingeschrieben und damit als „zugrunde liegendes Prinzip jeder Erfahrung performativer Prozesse“ (ebd.) bzw. als ein Hauptmerkmal performativer Phänomene erkannt werden (vgl. Brüstle et al. 2005). Verknüpft sich das persönliche Erleben in der Gegenwart sowohl mit Vergangenen als auch mit Kommendem, decken sich äußerliche Strukturierungen mit dem individuellen körperlichen Eigenrhythmus, kann dies spürbar Veränderung im Sinne eines Öffnens neuer Erfahrungsräume anstoßen. Erfahrene Differenzen können zur Befragung der eigenen Haltung einladen, zum Experimentieren ermutigen und zum Erfinden körperlicher Übersetzungen für Erfahrungen der Befremdung oder der Ungewissheit anregen.
Selbst wenn die Beschreibung einer Performance dem Einzelnen eine bildhafte Vorstellung und körperliche Anteilnahme ermöglicht, kann sie doch nie an die Vieldimensionalität der Erfahrung im Live-Moment heranreichen, denn – anders als in unserer Vorstellungswelt – tritt hier der oder die Andere als Gegenüber leibhaftig mit ins Geschehen ein und bestimmt den weiteren Verlauf in der Situation entscheidend mit. Auf uns selbst zurückgeworfen und mit eigenen inneren Bildern konfrontiert, stellt der performative Rahmen zugleich einen geteilten Erfahrungs- und Assoziationsraum bereit, in welchem körperliche Übersetzungen für Erfahrungen der Befremdung oder der Ungewissheit gefunden werden; und zwar im Sinne einer Übersetzung, die „eben nicht Verlust [ist], sondern Potenzieren der Differentialität, derer das Werk bedarf, um etwas bedeuten zu können“ (Reinhard 2012: 34). Und im Wissen darum, dass „Bedeutung […] durch Übersetzung erst performativ hervorgeholt [wird], weil der entstehende Sinn nicht allein aus sich selbst heraus, sondern im dialogischen Bezug zu dem, was ihm vorläufig ist, entsteht, jedoch auch nicht mit diesem mehr vollständig zur Deckung kommt“ (ebd.: 36).
Innerhalb dieser Rahmung setzt zeitgenössische forschende Performancepraxis gültige Konventionen außer Kraft und versetzt uns in die Lage, undurchdringlichen, existenziellen Widersprüchlichkeiten und Verunsicherungen zu begegnen, die wir üblicherweise auszublenden neigen. Komplexität wird in sinnlich erfahrbare skizzenhafte hybride Fragmente transformiert, die in kraftvollen, poetischen, skurrilen Bildern und alternativen Handlungsentwürfen zur Entfaltung kommen. Immer ernsthaft – jedoch nicht zwangsläufig ernst – kann dies befremdlichen Situationen bisweilen komische Perspektiven abgewinnen.
Der Körper folgt dabei einem Eigensinn. Einen solchen gesteht Hanne Seitz im Feld des performative research auch der künstlerisch-performativen Praxis im Feld sozialwissenschaftlicher und kunstpädagogischer Forschung zu und fordert eine Öffnung der Sozialwissenschaften für künstlerische Verfahren zur Herausbildung einer eigenständigen performativen Forschungspraxis, die entgegen einem rationalen wissenschaftlichen Forschungsverständnis „im künstlerisch-ästhetischen performativen Kontext ein Wissen privilegiert, das partikular, kontextbezogen und wenig greifbar ist, das mit Ambivalenz, Widerspruch, Zufall, sogar mit Nicht-Wissen umgehen kann – ein Denken mit Kunst, das die Zwischentöne und die »Räume im Dazwischen« bevorzugt“ (Seitz 2012: 92). Bewegt durch Affizierung, Berühren und Berührtwerden, im Gefüge eines undurchdringlichen Beziehungsgeflechts erwächst dem Körper eine Tatkraft, die im Kontakt, im Miteinander den Einzelnen übersteigt. Eigenen Gesetzen der Wirkmächtigkeit in Ausdehnung, Veränderlichkeit und Dynamik folgend, ist er ein bewegliches Kräftefeld, das sich der Festschreibung in eindeutigen Definitionen und Begriffen verweigert und sich einer vollständigen, willentlichen Steuerung und Kontrolle entzieht.
Zeitgenössische performative Forschungspraxis kann uns ein Bewusstsein und Gespür für unsere individuelle Wirkmächtigkeit, im Sinne eines körperlichen Vermögens zurückgeben. Dieses Vermögen bedeutet allerdings nicht, im Selbstbezug zu verharren. Es ist – im Sinne Hannah Arendts – vielmehr Voraussetzung für die Kontaktaufnahme mit anderen und für gesellschaftlichen Dialog. So erinnert Arendt uns, dass „das Wort selbst […], die deutsche ‚Macht‘, die sich von ‚mögen‘ und ‚möglich‘, und nicht von ‚machen‘, herleitet – […] deutlich auf den potentiellen Charakter des Phänomens hin[weist]“, und führt weiter aus: „Macht aber besitzt eigentlich niemand, sie entsteht zwischen Menschen, wenn sie zusammen handeln, und sie verschwindet, sobald sie sich wieder zerstreuen“ (Arendt 1981: 194).
Im bewussten Herstellen von Leerstellen wird Raum für Kontingenz, für etwas in seiner Differenz Unerwartetes geschaffen, d. h. für Prozesse, die sich einer Planbarkeit entziehen, die aus Unfertigem, Zögerlichem und Ungewissem Form annehmen. In diesem Sinne versucht Performance Art im Versagen der Interpretation und dem Suspendieren spontaner Impulse, der permanenten Tendenz zum Füllen des Leerraums durch Erklärungen entgegenzuwirken, indem sie zunächst Distanz schafft – Abstand, eine Lücke, eine „Pufferzone“, die jedoch in der Gleichzeitigkeit von Abwesenheit und Anwesenheit die sinnliche Präsenz noch steigert.
Über die bereits vielgestaltigen Erfahrungsmomente hinaus, die sich in Soloperformances zwischen Performancekünstler*innen und Betrachter*innen ereignen, findet innerhalb eines performativen Gruppengeschehens eine komplexe Steigerung des Wahrnehmungsangebots statt. Be- oder entsteht auch hier zu Beginn eine Leere, ist diese keineswegs als etwas Fehlendes zu beschreiben. Im Gewahr-Werden der Potenzialität, in der Ahnung des Kommenden, spannt sie sich zwischen den Körpern der Beteiligten aus, sodass etwas spürbar wird, das sich als eigenwillige Logik des Performativen in Open Sessions fassen lässt.
Der ergebnisoffene, nicht an einem Zielprodukt orientierte Charakter des Entwurfs scheint mir geeignet, um das Open Session-Format des seit 2010 bestehenden Performancenetzwerks PAErsche treffend zu beschreiben. PAErsche versteht sich als Labor verschiedener Disziplinen, das neue Formen von Soloperformances und die gemeinsame Arbeit in Open Sessions forschend vorantreibt und dem sich Künstler mit interdisziplinären Ansätzen aus Tanz, Theater, Literatur, Musik und der bildenden Kunst anschließen. Einzelne eröffnen den „Spielraum“, bis sich allmählich weitere Akteure im Geschehen einfinden und in das Feld der Begegnungsmöglichkeiten eintreten. Es entsteht ein – einem Schwarm vergleichbares – Gefüge, in dem sich die Beteiligten bewegen. Elemente der Interaktion wechseln mit scheinbar parallel ablaufenden Handlungsfolgen. Das mehrstündige Geschehen gleicht einem forschenden Arbeiten, das nicht an der Bestätigung oder Verwerfung zuvor aufgestellter Theorien interessiert ist, sondern sich als offener Prozess versteht, „noch unbekannte Antworten auf Fragen [zu] geben, die der Experimentator ebenfalls noch gar nicht klar zu stellen in der Lage ist“ (Rheinberger 2001: 22).
Hierbei setzt das von Krassimira Kruschkova beschriebene „Denken des Kollaborativen“ ein, „der instabilen Gegenläufigkeit, das sich der eigenen Uneinlösbarkeit aussetzt, das nur momentane Stabilisierungen statt eines permanenten Gleichgewichts kennt“ (Kruschkova 2013: 183). Sie präzisiert: „Die Idee vom Mitsein, von einer Gemeinschaft derer, die keiner angehören, setzt […] kein Gemeinsames einer Gruppe, keinen gleich bleibenden Plural voraus, sie setzt sich dessen Mangel aus“ (ebd.). Der Verzicht auf die Zusammengehörigkeit erlaubt eine erneute Begegnung der Einzelnen, „ein Zusammenhalten des Geteilten und Differenten“, jedoch „ohne Symmetrie, Einlösung, Rückerstattung“ (ebd.: 183). Innerhalb der Open Sessions entstehen ganz in diesem Verständnis fragile Gebilde des Zusammenhangs, die sich auflösen, wenn man sie zu fassen sucht, als ob in der annähernden Betrachtung des erst zu Fassenden die eben noch aufscheinenden Konturen schon wieder zerfallen. Erst im Zurücktreten, im Ausbremsen eines zwingenden Wissen-Wollens, im bewussten Zurücknehmen des Einzelnen, im vorläufigen Suspendieren des Eigenen, im Moment aus-fokussierender Unschärfe kehrt etwas Fassbares in die Entwicklung einer Situation oder eines Bildes zurück. Diese Erfahrung setzt jedoch die Bereitschaft zum Umschalten in einen veränderten Wahrnehmungsmodus voraus, der es erlaubt, in abwartender Achtsamkeit dem Entstehenden, Sich-Zeigenden Raum zu gewähren. Die solchen Räumen innewohnende Zeitlichkeit und Ordnung kann dann im Austausch mit den Beteiligten etwas Neues stiften – was sie allerdings zu affizieren vermögen, „hängt dann wiederum mit der Geschichtlichkeit derer zusammen, die sie betreten und somit in Konfrontation mit ihrer Erzählung zu transformieren beginnen“ (Reinhard 2012: 49).
Performance Art wird immer mit Idealen in Konflikt geraten, die in einem lückenlosen, absoluten Streben nach Perfektion und Überwindung von Differenz die Sinnlichkeit des Lebendigen und die potenzielle Bedeutsamkeit von Entwürfen vermissen lassen. Sie wird sich einer, auf ökonomische Verwertung ausgerichteten Reduktion und Instrumentalisierung von Sinnlichkeit entgegenstellen, die sich in einer oberflächlichen, rudimentären Rezeption erschöpft. Und sie wird uns das Körperliche in seiner Widerständigkeit, Differenz und geheimnisvollen Uneinholbarkeit erfahren lassen, nicht zuletzt um Vertrauen in dessen Glaub-Würdigkeit (zurück) zu gewinnen.
Im bewussten Loslassen des Geländers der Begrifflichkeiten ermuntert sie uns als performative künstlerische Forschung zum Eintritt in das Feld eines noch unbekannten, dynamischen, relationalen und spürbaren taktilen Wissens. Daher schließe ich mit der Empfehlung, der herkömmlichen wissenschaftlichen Erkenntnisgenerierung in Bildungsprozessen eine selbst-bewusste Performancepraxis an die Seite zu stellen, die sich an die Grenzen des sicheren Terrains bewegt, um am Abgrund des Vertrauten jenen Schritt zu wagen, zu dem Hilde Domin ermutigt: Ich setzte den Fuß in die Luft – und sie trug (Domin 2009: 47).
Anmerkung
1 Exemplarisch sei auf Beiträge von u. a. Elke Bippus, Michaela Ott, Henk Borgdorff, Jens Badura, Florian Dombois, Julian Klein zur internationalen Entwicklung von Künstlerischer Forschung in inzwischen vielfältig vorliegenden Textbänden zu Künstlerischer Forschung verwiesen.
Literatur
Arendt, Hannah (1981 [1958]): Vita Activa oder Vom Tätigen Handeln. Zürich, München: Piper.
Bippus, Elke (2009/12): Kunst des Forschens – Praxis eines ästhetischen Denkens. Zürich, Berlin: Diaphanes.
Brüstle, Christa/Ghattas, Nadia/Risi, Clemens/Schouten, Sabine (Hrsg.) (2005): Aus dem Takt. Rhythmus in Kunst, Kultur und Natur. Bielefeld: Transcript.
Domin, Hilde (2009): Sämtliche Gedichte. Frankfurt/Main: Fischer.
Gronau, Barbara/Ghattas, Nadia (2007): Zeitwahrnehmung. In: Lechtermann, Christina/Wagner, Kirsten/Wenzel, Horst (Hrsg.): Möglichkeitsräume. Zur Performativität von sensorischer Wahrnehmung. Berlin: Schmidt.
Klein, Julian (2010): Was ist künstlerische Forschung? In: Stock, Günter (Hrsg.): Gegenworte 23, Wissenschaft trifft Kunst. Berlin: Akademie, S. 25-28.
Krauthausen, Karin (2010): Vom Nutzen des Notierens. In: Krauthausen, Karin/Omar, W. Nasim (Hrsg.): Notieren, Skizzieren: Schreiben und Zeichnen als Verfahren des Entwurfs. Bd. 3. Zürich, Berlin: Diaphanes.
Kruschkova, Krassimira (2013): Mitsein und Widerstand. In: Böhler, Arno/Herzog, Christian/Pechriggl, Alice (Hrsg.): Korporale Performanz. Zur bedeutungsgenerierenden Dimension des Leibes. Bielefeld: Transcript.
Liechti, Martin (2000): Erfahrung am eigenen Leibe. Taktil-kinästhetische Sinneserfahrung als Prozess des Weltbegreifens. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
Mark, Elke (2012): Taktiles Wissen. Eine Lecture Performance. In: Schmitz, Thomas H./Groninger, Hannah (Hrsg.): Werkzeug/Denkzeug. Manuelle Intelligenz und Transmedialität kreativer Prozesse. Bielefeld: Transcript.
Mersch, Dieter (2009): Kunst als epistemische Praxis. In: Bippus, Elke (Hrsg.): Kunst des Forschens – Praxis eines ästhetischen Denkens. Zürich, Berlin: Diaphanes.
Polanyi, Michael (1966): The Tacit Dimension. London: University of Chicago.
Reinhard, Miriam N. (2012): Entwurf und Ordnung. Bielefeld: Transcript.
Rheinberger, Hans-Jörg (2010): Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Göttingen: Wallstein.
Seitz, Hanne (2012): Performative Research. In: Fink, Tobias, u. a. (Hrsg.): Die Kunst, über Kulturelle Bildung zu forschen. München: kopaed.
Abbildung
Abb. 1: Zeichnung: Elke Mark