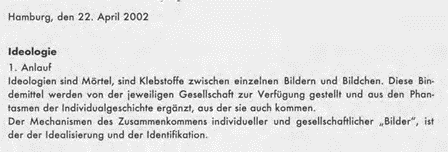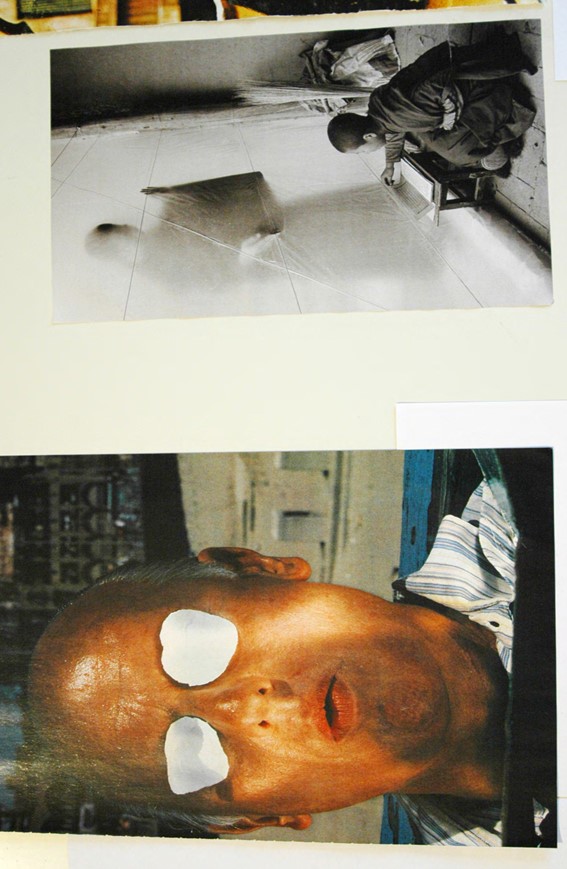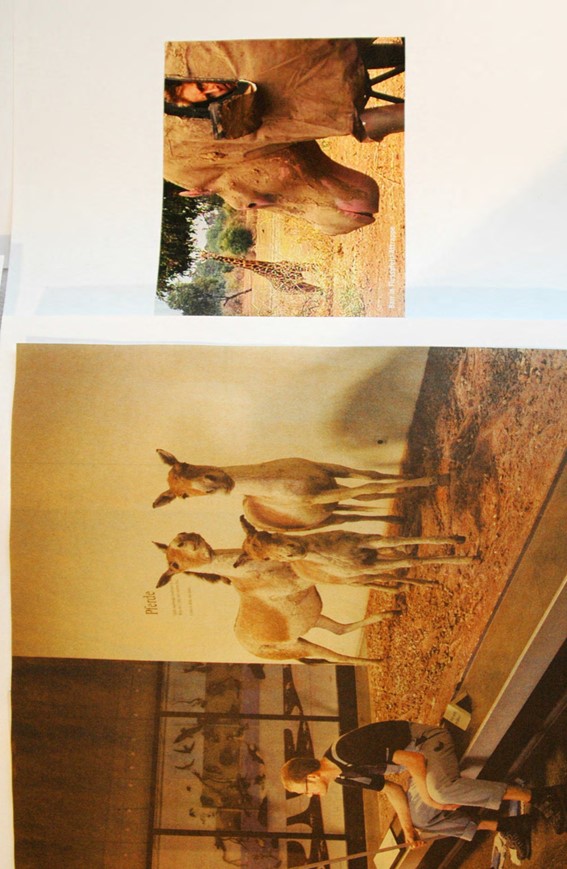Zwischen Bildern und Betrachter*innen – Wie Bilder uns ausrichten
Von Andrea Sabisch
Mit dem folgenden Beitrag stelle ich bild- und medientheoretische Überlegungen zur Bildungstheorie an. Diese knüpfen insofern an Karl-Josef Pazzinis aktuelle Monographie „Bildung vor Bildern“ (Pazzini 2015) und seine Habilitationsschrift „Bilder und Bildung“ (Pazzini 1992) an, als sie seine unterschiedlichen Analysen als Darstellung bildbasierter Bildungsprozesse begreifen und daraus einen Aspekt hervorheben, der sich durch die Beiträge wie ein roter Faden hindurchzieht: die Frage nach den komplexen Relationen und Interaktionen, die zwischen Bildern und Betrachter*innen geschehen. Diese Verhältnisse und Bewegungen lassen sich nicht im Sinne von Subjekt-Objektgegenüberstellungen denken, sondern als wechselseitiges raum-zeitliches Bedingungsgefüge von Bildwerdung und Subjektbildung. Im Zentrum steht also die These, dass die Subjektivation an Medialität, hier: an Bildlichkeit gekoppelt ist, „weil es der Medien bedarf, um sich zu bemerken.“ (Pazzini 2015: 175)
Aber wie bedarf es der Medien? Wie kann das Mediale Selbst- und Weltverhältnisse verändern und zu deren Konstitution beitragen? Was bergen sie für bildungstheoretische Implikationen? Worin besteht die Wirkung und Kraft des Medialen, hier des Bildlichen, um unser Sehen, Denken und Handeln zu modifizieren?
Um diesen Fragen in aller gebotenen Kürze nachzugehen, frage ich mit Dieter Mersch zunächst danach, wie theoretische Zugänge zum Medialen gedacht werden können. Ausgehend von dieser medientheoretischen Perspektive zeige ich exemplarisch an Marc-Antoine Mathieus Arbeit 3 Sekunden zwei verschiedene Weisen medialer Performanz im Visuellen, um daran bildungstheoretische Fragen zu konkretisieren. Damit schlage ich vor, neben die Idee der Bildung als Transformation nach Kokemohr und Koller (vgl. Koller 2012) auch eine in medialen Architekturen wurzelnde Performation als Dimension von Bildungsprozessen zu reflektieren.
Zugänge zum Medialen
In einem Aufsatz von 2010 unterscheidet Dieter Mersch zwei Zugänge zum Medialen, indem er zwei Begriffe heuristisch einander gegenüberstellt, um unterschiedliche Weisen der medialen Konstitution, bzw. Generativität zu entwickeln. Auf der einen Seite stehe die griechische Präposition oder das Präfix meta, (im Lateinischen trans), die mit „‚nach‘, ‚hinüber‘, ‚von … weg‘, ‚in der Mitte‘, ‚unter‘“ übersetzt werde, „wobei jedes Mal die Überschreitung einer Grenze impliziert“ sei (Mersch 2010: 200). Auf der anderen Seite stehe dia, im Lateinischen mit per übersetzt, das mit „durch“ oder „mittels“ übersetzt werde und sich nur nuancenhaft vom Meta unterscheide (vgl. ebd.: 202).
Der erste Zugang zum Medialen, den Mersch dem Begriff Meta zuordnet, sei als „radikaler Medienbegriff“ zu verstehen, „der das Mediale als ein unhintergehbares Apriori postuliert, und zwar so, dass das Medium immer schon auf das Mediatisierte einwirkt, es verwandelt und umprägt“ (ebd.: 187). Dieser Medienbegriff werde in Bezug auf den Modus der „Übersetzung“ und „Übertragung“ verwendet, wie er in dem Begriff der „Metapher“ aufscheine; er sei fortan „für alle weitere Medientheorie leitend geworden“ (ebd.). Gleichwohl berge dieser universale Status des Medienbegriffs Probleme, da kaum mehr „zwischen dem Medialen und Nichtmedialen“ unterschieden werden könne und der Medialität kein Ort zuzuweisen wäre (ebd.: 188). Zudem erweise sich die Beschreibung der spezifischen Medialität als Problem:
Was wäre z. B. die spezifische Medialität von Sprache: ihre propositionale Struktur, wie manche Philosophen unterstellen, die figurale Kraft des Rhetorischen, ihre kommunikative Funktion, das Illokutive des Sprechakts, die gesamte Szene der Verständigung oder die Schrift, die ihr, wie Derrida es ausdrückt, ‚über den Tod des Autors hinaus‘ eine Dauer und Geschichtlichkeit sichert? Gewiss liefern alle diese Bestimmungen ‚Beiträge‘ zu dem, was das Mediale der Sprache ausmacht, doch bedeutete jede Auszeichnung eines Gesichtspunkts bereits den Ausschluss oder die Herabsetzung der anderen und damit einen Reduktionismus – wie auf der anderen Seite die Anerkennung aller Aspekte zusammen auf die Tautologie zuliefe, die Medialität von Sprache sei die Sprache selber. Es gibt folglich keine ausschöpfende Medienphilosophie der Sprache, die sie nicht wesentlich engführte oder in ihren Möglichkeiten beschnitte. (ebd.)
Mehr noch: eine solche Medienphilosophie würde, wie es bei Luhmann der Fall sei, das Mediale in jene Formen verlagern, die es selbst generiere und „das hauptsächliche Problem [bestünde, AS] in der Identifikation der Formen selbst, weil diese wiederum nicht unabhängig von ihren medialen Bedingungen existier[t]en“ (ebd.: 189). Um diesem Paradox zu entgegnen, habe Wittgenstein in seinen Philosophischen Untersuchungen stattdessen vorgeschlagen, „von der Praxis des Sprechens anhand von ‚Sprachspielen‘“ auszugehen und durch ihre Verwendungsweisen die Sprache in ihrer Medialität zu enthüllen (ebd.: 188f.). Für Mersch dient dies „als Modell für eine ‚andere‘ Medienphilosophie“, die „weder das Mediale in einem Modus von ‚Übertragung‘ verankert noch in ihr eine ‚Transzendentalität‘ erblickt” (ebd.: 189).
Er schlägt stattdessen vor, einen zweiten Zugang zum Medialen zu verfolgen, den er mit dem Begriff dia, bzw. dem lateinischen Synonym per fasst:
So weist per-sona auf die Medialität der Maske, die verhüllend-enthüllend ein Gesicht dadurch offenbart, dass sich die Stimme ‚durch‘ (per) einen Laut (sono) artikuliert, wie die per-spectiva wörtlich ,eine Durchsehung‘ (Dürer) bedeutet, die sich […, AS] ‚durch‘ jene mathematische Struktur zu erkennen gibt, die das Sichtbare allererst gewährt. Ähnliches gilt für die Platonischen dialogoi, die ‚Durchsprechung‘ [dialogizomai], welche eine Erörterung vermittels des logos vollzieht, um einen Gedanken oder eine Überzeugung auf ihre geteilte Wahrheit hin ‚durchsichtig‘ zu machen, wie die diáphora an die Saat und den Sämann, d. h. die Urszene der Dissemination, gemahnt. (ebd.: 202)
Liege den hier genannten begrifflichen Beispielen – ebenso wie beim Über-setzen und Übertragen des Meta – „eine Differenz oder Teilung zugrunde“, werde sie hier jedoch „nicht übersprungen“, sondern „mittels der poiesis und ihrer materiellen Bedingungen ‚durch‘gearbeitet“ (ebd.: 202). Dem gegenüber ergebe sich beim radikalen Medienbegriff des Meta die Schwierigkeit, „ein Getrenntes miteinander zu verbinden, ohne dass klar würde, was die Verbindung stiftet“, insofern ließe er „im Dunkeln, von woher oder wodurch die Vermittlung geschieht, weil es vom Sprung oder Übergang nicht selbst wieder eine Vermittlung geben kann“ (ebd.: 200). Das Mediale, verstanden als Meta sei „nämlich einer Differenz geschuldet, deren Differenz selbst offen bleibt“ (ebd.). Um zu verstehen, wie der Sprung des Meta zu denken sei, beschreibt Mersch den Vorgang des Über-setzens, den „Inbegriff des Medialen“, als einen riskanten Sprung „zwischen den Sprachen, der beide, sowohl die übersetzende wie die übersetzte, tangiert“, und sich ohne „tertium comparationis“ realisiere, der zugleich deplatziere und grundlegend verändere, „ähnlich wie eine Transformation keine bloße Umgestaltung bedeutet, sondern eine metamorphosis.“ (ebd.: 201)
Im Unterschied zur grundlegenden, ereignishaften Verwandlung in der Transformation aktualisiere eine Performation im Sinne des Dia eine Aufführung, Verkörperung oder Dar-stellung. Dazu Mersch: „Nicht die Verwandlung ist dann das Resultat, sondern, im Wortsinne, die ‚Dar-Stellung‘ […, AS]. Dann steht auch nicht länger die ‚Über-Tragung‘ oder das metapher- ein als Paradigma für den Prozess der Mediation ein, sondern jene Formen des experiens oder Experimentellen, durch welche etwas zur Erscheinung gelangt, ‚gesetzt‘ oder ‚ausgesetzt‘ wird, um sich ebenso in der Wirklichkeit zu manifestieren wie diese zu ‚ent-setzen‘“ (ebd.: 203) und so Neues hervorzubringen (vgl. ebd.).
Die Weise des Überspringens werde beim Dia gekoppelt an die „Materialität von Übergängen sowie die Praktiken der Verwandlung von etwas in etwas ‚durch‘ etwas anderes.“ (ebd.: 201) Sie setze insofern „weniger vertikal und ‚sprunghaft‘“ ein, als die Transformation, sondern verlaufe „vielmehr horizontal und damit flacher und bescheidener“ (ebd.). Im Unterschied zum ereignishaften, ortlosen Begriff des Medialen beim Meta, deuten sich im Dia „verschiedene Wege oder Modalitäten an, den Übergang zu gewährleisten“; eingebettet „in ein Netzwerk von Dingen und Handlungen beruht das Mediale folglich auf performativen Praktiken und nicht im Ereignis einer différance. Deswegen auch die Betonung auf die Praxis der Künste: Anstelle einer Metabasis, eines Übergangs in eine andere Ordnung, verfolgen sie eine Diabasis, die zwar gleichfalls einen Übergang nennt, jedoch vermöge solcher Passagen, die auf konkreten ‚Architekturen‘ bauen.“ (ebd.: 203)
Auf der einen Seite steht bei Mersch also ein radikaler Medienbegriff des Meta, der sich die sprachliche Konstitution zum Vorbild nimmt und im Sinne von Derridas différance aufgefasst werden kann, auf der anderen Seite ein gemäßigter Medienbegriff, der das Mediale zurückbindet an konkrete Praktiken. Er geht von einer „ununterbrochenen Kette horizontaler Verschiebungen aus […, AS], deren konstitutive Effekte in jedem Einzelfall allererst zu überprüfen wären“ (ebd.: 205) und nicht wie in den meisten Medientheorien bereits vorausgesetzt würden (ebd.: 192). Dementsprechend liege der Fokus darauf, was solche Verschiebungen „auf der kommunikativen Szene bewirken. Nicht die Frage des Symbolischen ist für das Mediale relevant, sondern die an Akteure und Kontexte sowie an Diskurse und Materialitäten gebundenen Praktiken, um im eigentlichen Sinne situativ ‚durchzuschlagen‘.“ (ebd.: 205) Auch wenn ich hier die Zuschreibung zu paradigmatischen Mediationsprozeduren als Gegenüberstellung der sprachlichen Konstitution einerseits und der Praxis der Künste andererseits für problematisch erachte, weil sie eine Dichotomie zwischen Sprache und Bild/Kunst weiter festschreibt, die so m. E. nicht zu halten ist – mit Sybille Krämer könnte man erwidern, dass Bild und Sprache keine Gegensätze, sondern zwei Pole einer Skala darstellen1 –, erweist sich die Differenzierung und zugleich die Ausweitung der Zugänge zum Medialen auch für Bildungsprozesse als interessanter Aspekt. Sie überführt nämlich im Zeitalter des Audio-Visuellen die virulente Konstitutionsfrage des Medialen, die auch für die Bildungsprozesse aktuell bedeutsam ist, in eine Frage der Modalitäten und der Produktion (Mersch 2010: 206). Mersch behauptet: „Vielmehr wandelt sich die Konstitutionsfrage zum Modusproblem“, es gehe im Medialen „um das Ereignis des Als“, da sich „je nach der Szene des Performativen in ein mediales Als allererst umschreibt. Das Mediale fungiert also nicht als eine primordiale Hypothese, sondern existiert allein in Abhängigkeit jener Praktiken und Materialitäten, deren ‚Ver-Wendung‘ es zugleich auf immer neue Weise ‚wendet‘. Was das Mediale ist, kann nicht gesagt werden – es entzieht sich seiner Feststellbarkeit; gleichwohl zeigt es sich durch seine ‚Bewegungen‘ und deren ‚Wendungen‘ hindurch. Sie dulden sowenig eine Synopsis wie eine allgemeine Theorie, bestenfalls nur regionale Kasuistiken von Fall zu Fall. Medien situieren sich, jenseits operativer Strukturen, in einem indeterminativen Feld von Potentialitäten: Sie sind nicht – sondern sie werden erst.“ (ebd.)
Überträgt man die von Mersch beschriebenen medialen Zugänge und deren generative Dimension auf die Bildungstheorie, wäre zu fragen, wie sich mediale Modalitäten zeigen und wie sie unser Sehen und Denken verändern können.
Mediale Performanz
Um die Frage der Performation im Sinne des Dia bei Mersch exemplarisch zu untersuchen, wähle ich den 2011 entwickelten Comic 3 Sekunden von Marc-Antoine Mathieu aus, den der Zeichner selbst an den Hamburger Graphic-Novel-Tagen im Literaturhaus Hamburg 2012 präsentierte. Laut Klappentext versucht das Werk bildhaft den „Verlauf eines Lichtstrahls in einem kleinen Ausschnitt von Zeit und Raum einzufangen. Die drei Sekunden, die er umfasst, erzählen eine sehr kurze, aber auch hoch konzentrierte Geschichte in Form eines Krimis. Das Beobachten der Details und die Erforschung der Schauplätze ermöglichen es, tote Winkel zu rekonstruieren und Indizien zusammenzutragen, aus denen sich die Beziehungen der Personen und die Motive erschließen lassen.“ (Mathieu 2012)
Bezogen auf meine Frage, wie kraft der Medialität unser Sehen durch Bilder modifiziert wird, bietet diese Arbeit den Vorteil, dass Mathieu sie als hybrides Werk konzipierte, indem er sowohl eine Version im Medium des Buches erstellte als auch eine zweite Version mit exakt derselben Bildfolge im Medium des Films, genauer: als digitalisierte Animation (vgl. Mathieu 2012b). Das Interessante beider Arbeiten liegt dabei weniger auf der semantischen Ebene als vielmehr auf der medialen. Es besteht darin, dass es – trotz übereinstimmender Bilder – zu völlig unterschiedlichen Seherfahrungen kommt. Wie kann dies geschehen?
Alle Interpretationsmethoden der reinen Inhaltsanalyse wie auch der Einzelbilder fänden hier ihr Ende, denn Mathieu geht es mit der spezifischen medialen Gegenüberstellung um eine differenziertere und weiter reichende Betrachtung, die die Verknüpfung von Form und Inhalt ebenso betrifft wie die Verkettung der Bilder miteinander, also gewissermaßen die Bildsyntax, als auch um die Verwobenheit von Darstellung und Wirkung. Es geht also nicht länger um das Bild im Singular, sondern um die gegenwärtig in der Bildtheorie debattierte Frage nach dem Bild im Plural (vgl. Ganz/Thürlemann 2010).
Aber wie prozessieren und modifizieren die beiden Medien unterschiedliche Weisen der Bildbetrachtung? Wie richten sie uns im Betrachten aus?
Einerseits zeigt Mathieu mit seinem Buch insgesamt 602 Einzelbilder in quadratischem Format, die jeweils in neun Einzelbildern pro Seite (drei Panels à drei Bilder) angeordnet sind und durch einen schmalen schwarzen Rahmen und weiße Bildzwischenräume voneinander getrennt sind. Das Fortschreiten der Bildhandlung wird also in den kinetischen Vollzug der Bildbetrachtung verlagert, der sich nicht nur an der westlichen „Leserichtung“ im Buch festmacht, sondern zudem auch auf eine selbstbestimmte zeitliche Orientierung der Betrachtung verweist, die sich im Vor- und Zurückblättern der Rezipient*innen zeigt. Die Bilder verteilen sich auf verschiedene Seiten im Buch und knüpfen damit an mehrteilige Bildformen an, die auf verschiedene Orte verteilt sind (vgl. Pichler 2010: 120). Vergleichbar mit den bildhaften Darstellungen des Kreuzweges der christlichen Ikonographie, bei denen man analog zum Leidensweg Christi einen Weg abschreitet, kann man im Verfolgen der bildhaften Reihenfolge bei Mathieu den Weg des Lichtstrahls als lineare Bildverkettung nachvollziehen. Gleichwohl erhalten wir im Wahrnehmungsprozess die Möglichkeit, diese chronologische Betrachtung intervallhaft zu unterbrechen, um z. B. die Einzelbilder genauer zu betrachten, um die gesamten Buchseiten als überblicksartige Bildensembles anzusehen oder um lediglich einzelne Übergänge zwischen den Bildern auszuloten, die durch die Vergrößerung und den verschobenen Bildausschnitt z. B. verfremdend wirken. Die Rezeption des Buches lässt uns also eine körperliche Bewegungsfreiheit, um die zeitliche und räumliche Organisation der Bildverknüpfung im sequenziellen Vergleich und in ihrer Verschiebung und Vergrößerung wahrzunehmen. Dies geschieht allerdings – trotz des zentralperspektivischen Bildraums – auf Kosten einer Durchsicht (per-spectiva). Andererseits zeigt Mathieu mit der animierten Darstellung im Medium des digitalen Films, dass die Bilder hier gewissermaßen durch ein Einzelbild hindurch erscheinen. Die Bilder im Plural sind hier nicht nebeneinander angeordnet, sondern in Ebenen oder Schichten. Sie werden vor allem durch Bildverschachtelungen, wie Bild-im-Bild (Mise en abyme)-Kompositionen und als Figur-Grund-Relationen zusammengehalten. Hierbei entsteht der Eindruck, dass uns die gezeichneten Bildobjekte entgegentreten und es zugleich eine Sogwirkung in das Bild hinein gibt, die uns in das Bildgeschehen verwickelt. Es ist kein Zufall, dass in der Rezension zu 3 Sekunden behauptet wird: „Wir folgen nicht nur einem Blick, sondern sind dieser Blick selber [Kursivsetzung AS], der wie ein nicht enden wollender Zoom, eine Vergrößerung und Annäherung, sich immer weiter fortbewegt.“ (Schlüter 2012) Aber erstens geht es hier nicht um einen Blick, sondern um einen Lichtstrahl, der erst die Fiktionalisierung des Blickes, den wir niemals selbst einnehmen könnten, ermöglicht. Und zweitens ist mit der Fortbewegung auch eine Bewegungslosigkeit verbunden. Während wir also die verschiedenen Einstellungen, Perspektiven und Kamerabewegungen als Blickausrichtungen erfahren, wird das betrachtende Subjekt körperlich stillgestellt, denn der Blick ist durch das zentralperspektivische Zoomverfahren zwanghaft auf die Bildmitte fokussiert. Je schneller wir den Film abspielen, desto stärker erleben wir die körperliche Zurichtung auf einen Flucht-, bzw. einen Augenpunkt. Solange wir die Handlung verfolgen wollen, dürfen wir nicht einmal zwinkern, geschweige denn, einem Bildbegehren oder Aufmerksamkeitsgeschehen nachgehen. Dies gelingt indes nur, wenn wir den Blickfluss und damit auch unsere Seh- und Bilderfahrung unterbrechen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kontinuierung in der digitalen Filmversion durch die Fokussierung auf die Bildmitte als fixer Augenpunkt hergestellt wird, der die Bilder in die Tiefe hinein verklammert und eine Durchsicht ermöglicht, sodass der Eindruck eines Sogs entsteht. Die Ränder und Grenzen der Bilder werden hingegen nur lateral wahrgenommen, sodass eine Orientierung vor allem innerhalb des Bildraums möglich scheint. Insofern bestätigt sich der Eindruck, dass unser Blick und der Lichtstrahl sich überlagern, wir erleben scheinbar durch unseren Blick, der Licht gibt, einen visuellen Anschluss, indem sich das Bildkontinuum auf das nächste Bild hin öffnet. Insofern kippt das Bildkontinuum in den Status des entwerfenden Bildes und konstituiert das Bildhafte der Reihung erst durch den Modus des Medialen. Nach Didi-Huberman ist es vor allem diese „vorübergehende, gewagte, symptomale Fähigkeit, Erscheinung zu werden“, die das Bild als virtuelles Kontinuum charakterisiert (Didi-Huberman 2000: 197) und es auf andere Bilder hin öffnet. (vgl. dazu auch Sabisch 2015)
Die Kontinuierung im Medium des Buches indessen kennt diese Öffnung auch, doch findet aufgrund der räumlichen Verteilung der Bilder im Buchformat eine distanziertere Sequenzialisierung statt, die den Fokus auf die verschobene Wiederholung der Einzelbilder verlagert, sodass eine gruppenweise Übersicht über die Bilder mitsamt ihren Rahmungen, den Verschiebungen in Rahmungen und Montagen sichtbar wird. Zudem verlagert sich das Blickgeschehen auf den Raum vor dem Bild. Neu hinzukommende Details können dann im eigenen Tempo vergegenwärtigt werden und manche Wiederholungen (wie etwa die Mondserie) können, trotz ihres medialen Witzes, in Bezug auf die semantische Dimension übersprungen werden. Was bedeuten diese exemplarischen Beschreibungen der Subjektbildung und -ausrichtung durch mediale, hier: durch visuelle Architekturen und Performanzen?
Bildung ‚durch‘ Bilder
Wenn ich eingangs mit dem Zitat von Karl-Josef Pazzini behauptet habe, dass es der Medien bedürfe, um eine Subjektbildung zu ermöglichen, habe ich am Beispiel Mathieus gezeigt, wie das Mediale, d. h. das Visuelle der Bildverknüpfungen an Prozessen der Subjektivation beteiligt sein kann und wie Welt-und Selbstverhältnisse durch das Mediale jenseits einer reinen Abbildlogik modifiziert werden können. Was aber bedeutet das für die Bildungstheorie?
Zunächst können Bilder als Anlass für Bildungsprozesse dienen. Um jedoch nicht von einer Analogie der Sprache und des Bildes auszugehen, sondern den Bildern eine genuine eigene Erkenntnisgenerierung zuzugestehen, schlägt Pazzini einen „Entzug aus den sprachnahen Symbolisierungsmodi“ als Bildungsanlass vor (Pazzini 2015: 30f.). Dieser Entzug erhöht derzeit – zumindest im Kontext gegenwärtiger schulischer Textorientierung – die Möglichkeit der Fremderfahrung und die Bildungswahrscheinlichkeit.
Aber auch auf der Ebene der Welt- und Selbstverhältnisse spielen mediale Prozesse eine immense Rolle für Bildungsprozesse. Pazzini hat das wechselseitige Bedingungsgefüge von Bild- und Subjektbildung a. hinsichtlich der zentralperspektivischen Darstellung immer wieder betont 2 und neben der Rationalisierung auch deren unbewusste „Abspaltungsprodukte“ herausgearbeitet, die in der Psychoanalyse thematisch werden (Pazzini 1992: 64).
Versteht man Bildung ferner mit Hans-Christoph Koller als „Prozess der Transformation grundlegender Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses angesichts der Konfrontation mit neuen Problemlagen“ (Koller 2012: 17), wäre die Frage des medialen Zugangs, wie ich es mit Mersch skizziert habe, eine weiter zu verfolgende Frage, die sowohl die Transformationen betrifft als auch die Entstehung des Neuen. Die rhetorischen „Figuren“ nach Kokemohr könnten auch auf visuelle Konstellationen, Figurationen und Performanzen hin ausgedehnt werden, wie ich es am Beispiel von Mathieu angedeutet habe. Dabei spielt das Bild im Plural eine herausragende Rolle, da es die sequenziellen und topologischen Bildordnungen und Bildperformanzen berührt, die das Subjekt allererst bilden. Im Sinne von Merschs Dia werden diese Konstellationen für die empirische Erforschung darstellbar.
Folgt man ferner dem Kunsthistoriker Robert Kudielka in der Annahme, dass in der Kunst hinsichtlich der Bilder im Plural ein „Wandel vom Gegenstand der Betrachtung zum Ort der Erfahrung“ zu verzeichnen sei und eine im 21. Jahrhundert zunehmende „Aktualisierung des Bezugs zwischen Betrachter und Bild“ feststellbar sei, könnte man für die Bildungstheorie ableiten, dass Bildsequenzen viel stärker als mediale „Orte der Erfahrung“ und der Bildung verstanden werden können, die Subjekte platzieren und ausrichten (Kudielka 2005: 46). Wäre es angesichts dessen nicht an der Zeit, den sprachtheoretischen Legitimationen der Bildungstheorie bildtheoretische Grundierungen an die Seite zu stellen?
Anmerkungen
[1]„„Was aber, wenn ‚Sprache‘ und ‚Bild‘‚ somit das Sagen und das Zeigen nur die begrifflich stilisierten Pole einer Skala bilden, auf der alle konkreten, also raum-zeitlich situierten Phänomene nur in je unterschiedlich proportionierten Mischverhältnissen des Diskursiven und Ikonischen auftreten und erfahrbar sind? Was, wenn es die ‚reine Sprache‘ und das ‚reine Bild‘, die wir als Begriffe zweifellos klar akzentuieren und differenzieren können und vor allem: auch müssen – als raum-zeitlich situierte Phänomene – gar nicht gibt?“ (Krämer 2009: 95).
[2] „Der Vorgang der perspektivischen Zeichnung ist einer der Auseinandersetzung mit dem Entstehen und Verschwinden des Subjektes.“ (Pazzini 1992: 86)
Literatur
Didi-Huberman, Georges (2000): Vor einem Bild. München: Hanser.
Ganz, David/Thürlemann, Felix (Hrsg.) (2010): Das Bild im Plural. Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart. Berlin: Reimer.
Koller, Hans-Christoph (2012): Bildung anders denken. Einführung in die Theorie transformatorischer Bildungsprozesse. Stuttgart: Kohlhammer.
Kudielka, Robert (2005): Gegenstände der Betrachtung – Orte der Erfahrung. Zum Wandel der Kunstauffassung im 20. Jahrhundert. In: Lammert, Angela/Diers, Michael/Kudielka, Robert/Mattenklott, Gert (Hrsg.): Topos RAUM. Die Aktualität des Raumes in den Künsten der Gegenwart. Nürnberg: Verlag für moderne Kunst, S. 44-57.
Mathieu, Marc-Antoine (2012a [2011]): 3 Sekunden. Ein Zoomspiel. Aus dem Französischen von Martin Budde. Berlin: Reprodukt.
Mathieu, Marc Antoine (2012b): 3 Sekunden. Ein Zoomspiel. Film Online: http://3sekunden. reprodukt.com/film.html [20.12.2016].
Mersch, Dieter (2010): Meta / Dia. Zwei unterschiedliche Zugänge zum Medialen. In: Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung, 2010, Bd. 2. Hamburg: Meiner, S. 185-208. Pazzini, Karl-Josef (1992): Bilder und Bildung. Vom Bild zum Abbild bis zum Wiederauftauchen der Bilder. Münster: Lit-Verlag.
Pazzini, Karl-Josef (2015): Bildung vor Bildern. Kunst – Pädagogik – Psychoanalyse. Bielefeld: Transcript.
Pichler, Wolfram (2010): Topologie des Bildes. Im Plural und im Singular. In: Ganz, David/
Thürlemann, Felix (2010), S. 111-132.
Sabisch, Andrea (2015): Visuelle Anschlüsse. In: Kolb, Gila/Meyer, Torsten (Hrsg.): What’s Next. Art Education – Ein Reader. München: kopaed, S. 290-292.
Schlüter, Christian (2012): Comic drei Sekunden – Der göttliche Blick. In: Berliner Zeitung vom 24.07.12. Online: http://www.berliner-zeitung.de/3774698 [20.12.2016].