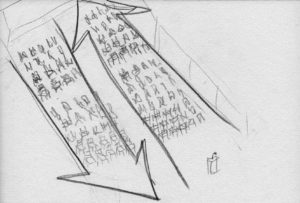You Cannot make Mistakes, it’s Art!
Von Reut Shemesh
Vermutlich bin nicht nur ich zur Kunst gekommen durch ein starkes sexuelles Interesse, das keine Objekte, keine Artikulationsmöglichkeiten im Alltag fand. Das gebilligte Angebot für Heranwachsende noch in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts machte nur deutlich, dass es das nicht sein kann. Auf eine andere Weise ist das heute so geblieben. Vielleicht besteht heute allerdings die Verwechslungsgefahr, das bekannte Angebot als Dokumentation dessen, was ist, anzusehen.
Das direkt, explizite, sexuelle Motiv war nicht das einzige: Es gab eine ganze Bandbreite sinnlicher Erregung, Anregung, Aufregung, die nach Artikulationen suchte aus der Einsamkeit des Einbildens heraus, aus der Erregung durch Verführung oder, eher von „innen“ gedacht, durch das, was man den Trieb[1] nennt. Das reicht von der sexuellen Neugier im engeren Sinne bis zur Lust am Verstreichen von Farben, der Lust an seltsamen Wirkungen bedeutungsfreier, abstrakter Formen, Farben und Gebilde.
Die je konkreten Einrichtungen des Sexuellen und dessen Erscheinungsformen kommen dem Kind noch sehr abstrakt vor. Abstrakt sind sie vor dem Hintergrund der körperlichen Möglichkeiten des heranwachsenden Kindes. Sie sind aus anderen, auch körperlich noch nicht erreichten Zusammenhängen herausgezogen. Abstraktion und Sexualität haben durchaus Gemeinsamkeiten. Mit Empfängnisverhütung ist das Leben der Sexualität höchste Abstraktion geworden, bei intensiver Konkretion und sinnlicher Intensität. Zum Verstehen reichte diese sinnliche Erfahrung aber noch nicht. So gab es Aktmalerei. Faszinierend bedeutungsfrei, „konkret“, aber abstrakt in Relation zum sinnvollen Alltag, aber nicht ohne Erregung, sinnlich. In einer Atmosphäre der Bipolarität des einerseits Anarchischen, Sinnesfreudigen, durch den moralischen Druck oft bis zum Kitsch Verdrucksten – zu Heiligenbildchen ist die Darstellung von Conchita Wurst ebenbürtig –, nie ganz Direkten, etwas im Unausgesprochenen lassenden Katholizismus wurde ich aufgeschlossen für Kunst, mit Ahnungen davon, dass man manches nicht abbilden kann oder sollte. Die Kunst war das, wie das nicht instrumentelle Denken in der Philosophie, was mich so stark berührte, neugierig machte, eine unklare, aber attraktive Verheißung einer Öffnung. Kunst und Philosophie nahmen die Erregung aus dem Alltag auf, aber nicht eigentlich zielführend, ein ambulantes Warten vor und in White Boxes.
Diese Bekenntnisse dienen als Vorzeichen und jetzt komme ich zu den Fragen, denen ich im Folgenden nachgehen möchte:
Fragen
Bringt die Pornographie[2] eine Präsentation und Repräsentation der Sexualität hervor? Tut sie das verschämt, indem sie die Scham protzig überspielt über Bilder, um nicht sprechen zu müssen? Ist Sexualität, wie im Übrigen auch das singuläre Subjekt, nicht unaussprechlich? Ist Pornographie Gefäß für bereitliegende Bilder, die aber nicht realisiert werden konnten, für Bilder, die nicht schon einfach vorhanden sind, sondern eher vage und in Fragmenten erahnt werden, Bilder, die beunruhigen?
Komplexitätsreduktion
Im Sinne der Systemtheorie handelt es sich bei der Pornographie um eine Komplexitätsreduktion der Liebe und des Sexuellen. Dazu gehört das Weglassen des vermeintlich Unwesentlichen, der Ballaststoffe, um das Sexuelle isoliert und dadurch ein wenig aseptisch zeigen zu können. Sexualität wird (z. B. heterosexuell) typologisiert: Es gibt den immer verführbaren und verführenden Mann, der immer potent ist und immer den Orgasmus der Frau und den eigenen erzielt. Es gibt entsprechend die immer begehrenswerte Frau, die eigentlich auch immer bereit ist zum Sex, oft auch die aktiv Verführende ist und die Maschine Mann in Gang setzt.
Sexualität ist affektnah. Wir haben aber zunächst dieses Konzept nicht zur Verfügung für Vorstellungen von befriedigenden Handlungen; sozusagen als gebündelte Abstraktion, erst recht nicht als „reife“ Sexualität. Das Bild der Befriedigung kann so oder so mit Ereignissen und Wünschen verbunden werden, polymorph pervers. Sie ist kontingent. Auf der individuellen Ebene muss die Geschichte des gerade einmal 175 Jahre alten Begriffs der Sexualität nachgeholt werden (Sigusch 2008: 46ff.). Der Begriff der Pornographie ist etwa gleichalt und wurde nach wenigen Vorkommnissen in der Antike (vgl. Moulton 2000: 8) bei der Ausgrabung Pompejis angesichts der die Ausgräber reizender Fresken in der heutigen Bedeutung virulent. An diese Fresken hing sich der Trieb, als er von diesen hervorgerufen wurde (Herz 2005: 17ff.). Der Trieb als solcher ist nicht fassbar, er braucht eine Repräsentanz im Psychischen, eine Vorstellung. Damit niemand daran zugrunde geht, muss diese Repräsentanz öffentlich werden in irgendeiner Darstellungsform. Daneben gibt es die Spannung des Affekts. Zwischen beiden muss etwas an Zusammenhang erfunden werden. An dieser erleichternden Zusammenhangsbeschreibung versucht auch die Pornographie zu arbeiten. Eine (logische) Negation der Unruhe und des Drangs ist nicht möglich. Der Trieb bleibt eine dauernde Arbeitsanforderung (vgl. Freud 1915: 81). Sichtbarmachen, Verführung, Schreiben und andere kulturelle Aktivitäten bilden den Trieb in dem Sinne, dass er bemerkbar wird. Freuds Fort-Da-Spiel (vgl. Freud 1920: 224-227) reflektiert die Einschnitte in den vom Trieb innen und außen (vom Kind und der Mutter) produzierten Fluss der Bedürfnisse (Lacan 1978: 249). Der Trieb ist nach Freud die Repräsentation eines Grenzgeschehens zwischen Natur und Kultur. Diese Grenze und damit auch die „kontinuierlich fließende Reizquelle“ erhält Energie von innen, von außen und im Grenzgeschehen selber, das wieder andere Quellen anzapfen kann. So ist der Trieb sozial und politisch (vgl. Freud 1905a: 91).[3]
Bild
Um der Befriedigung den Weg zu weisen, werden Evidenz und Assoziativität versuchsweise in Bildern vereinigt (vgl. Lewandowski 2012: 214). Diese Assoziationen sind nicht ausschließlich bewusster Natur. Stellt sich Evidenz ein, entlastet diese vom Sprechen und schafft Klarheit – ein bisschen gewaltsam. Sexualität kann niemand sehen. So kann man sich fragen: Ist Sexualität, das, was im Begriff gebündelt wird, ein Ursprung von Bildproduktion überhaupt, zur Generierung von Vorstellungen, die die Affekte begleiten könnten, zur Handlungsfähigkeit führten? Vielleicht ist die Zusammenschau vielfältiger Begehrens- und Befriedigungsformen im Begriff der Sexualität ein Anlasser für Bilder, stärker als die unter ihm vereinigten Strebungen?
Didaktik
Didaktik kann als Haltung oder Habitus verstanden werden, nicht unbedingt nur als handlungsnahe, -anregende und -anleitende Formulierung.[4] Dabei ist den jeweiligen Adressaten, in deren multimodaler Präsenz, unterstellt, dass sie etwas erfahren und das Risiko eines Erfahrungsprozesses eingehen möchten. Und der jeweilige Lehrer[5] will nicht auf dem sitzen bleiben, was ihn bewegt, möchte es loswerden, etwas von sich am Körper, im Sprechen und im Schreiben, im Malen oder Singen an Anderen, sich bewegen sehen. Was in den Köpfen vorgeht, wird nur mühsam und unzutreffend in Evaluationen sichtbar gemacht werden können. Das Begehren des Lehrers, der darauf aus ist, andere aus dem eigenen Engpass heraus in die Gesellschaft einzuführen, führt auf Abwege, auf andere als die schon bekannten Wege, verführt in diesem Sinne. Um individuell subjektive Willkür dabei zu vermeiden, ist Lehrerausbildung nötig: befragend, distanzierend, verallgemeinernd, getragen von Lehrern, die zusätzlich forschen. Forschung arbeitet mit einem befremdenden Blick, sieht schräg, entdeckt strukturelle Zusammenhänge.
Pornographie ist in ihrer Produktion und Konsumtion, ihrer Wirkung auf mehrfache Weise bilddidaktisch: Erstens führt Pornographie eine Struktur vor, wie Didaktik heute oft gewünscht wird. Klar, deutlich, anregend, affektiv, zielführend, zeitnah, effektiv und evaluierbar. Zweitens ist sie didaktisch in dem Sinn, dass sie in ein zumindest in dieser Perspektive kaum bekanntes Gebiet einführt, schwer zu Erkennendes zeigt und aus dem komplexen alltäglichen Zusammenhang herauspräpariert, zum Exemplarischen abstrahiert. Drittens zeigt Pornographie etwas, das es nicht gibt, das jedenfalls als stand alone nicht lebensfähig ist – wie die Gegenstände aller Didaktik. Viertens verlockt Pornographie zu voreiligen Schlüssen. Und es bleibt nach derartigem didaktischem Prozess nichts Anderes übrig, als das Gelernte zu dekonstruieren. Fünftens haben Pornographie und Didaktik mit dem Zeigen, Betonen und Hervorheben und dem Herausbilden von Präferenzen und Aufmerksamkeiten zu tun. Sechstens hat es Pornographie darüber hinaus auch mit dem Zeigen des Zeigens zu tun. Zeigen setzt die Möglichkeit voraus, auch ohne Berührung etwas zu sehen und vielleicht zu erkennen – Berührungslosigkeit wie im Museum. Der Hiatus, der durch die nicht möglichen oder verbotenen Berührungen entsteht, wird durch Schaulust überbrückt. Daher die medientechnologischen Aufrüstungen im Unterricht und der Test jedes neuen Mediums durch Pornographie.[6] Daneben gibt es Fragen und Kontexte, die Didaktik wie Pornographie gleichermaßen angehen: Wie wirken Bilder? Das ist auch eine Frage der Macht. Warum wirken Bilder? Das ist eine Frage der Bedürfnisse und der Ansprüche, damit auch der Artikulation und Repräsentation des Triebs.
Zeigen – Moment von Sublimierung
Zeigen ist eine wichtige Dimension jeglicher Didaktik (vgl. Giel 1969; Prange 1995 und Pazzini 1999). Frederico Ferrari und Jean-Luc Nancy bringen Zeigen und Entblößung im Akt reflexiv zusammen: Der Porno entblöße, er sei nichts Anderes als, dass es sich zeige oder gezeigt werde. „Der Zuschauer genießt nicht nur das, was er sieht, sondern genauer und nachlässiger gesagt, er genießt zu sehen und sich selbst zu sehen, wie er sieht, dass der Körper, den er sieht, gezeigt wird.“ (Ferrari/Nancy 2006:109). Bezogen auf Unterricht ginge es um zweierlei Körper, die dabei sichtbar werden: Der Corpus des Gelehrten, dessen enthüllte Zusammenhänge, herausgelöst aus der komplexen alltäglichen Verflechtung, aber auch um die Körper der Lehrenden, die sich zeigen, indem sie zeigen.
Zeigen – zunächst aus der Perspektive der Akteure im Porno – hat eine meist unbemerkte visuelle, kognitive und affektive Metaschlaufe, die wieder zurückgenommen werden muss, weil sonst das Stolpern und Stottern begönne, das aber nicht unerheblich für den Lustgewinn ist. Hier liegt die Notwendigkeit für eine minimale Story für Pornofilme. Hier liegt eine Quelle für die Generierung einer unbewusst entfachten Aufmerksamkeit – für Akteure und Betrachter. Bei der Pornographie wird das eher deutlich als in anderen didaktischen Situationen.
Und der Zuschauer, wenn es denn gelingt, ihn zu interessieren, genießt es, etwas wahrzunehmen, das ihm ein Anliegen ist, und er genießt sich dabei als Gemeinter, als jemand, der sich als existierend spürt, dass das sich zeigt, also zur Präsenz kommt, was ihn unter Spannung gesetzt hat. Das ist ein Idealfall in der Didaktik, insbesondere die Erlebnispädagogik zielt auf solche Events.
Ein Moment von Sublimierung läge in der Abstraktions- und Distanzierungsbereitschaft, etwas zu akzeptieren, das aus der Unmittelbarkeit in die Vermittlung tritt. Dieses Moment befördert die Gelegenheit zur Triebumwandlung. Sie wird auf andere Art bedingt durch Andere, die jenseits eines Schirms unerreichbar sind, die Adressaten nicht unmittelbar berühren können oder aufgrund ihres symbolischen Platzes (Lehrer*innen, Schüler*innen, bei Student*innen auf andere Weise) nicht dürfen. Es bleibt die Macht des Zeigens und die teilweise gleichzeitige Macht und zugleich Ohnmacht der Exposition, die man auch als Subjektivierung bezeichnen könnte.
Nach wie vor gilt in unserer Gesellschaft, dass jede als individuelles Subjekt selbständig zu sein und zu bleiben habe. Individuell oder in Gruppen[7] organisiert zu genießen, die sich ad hoc für den Zweck des Genusses an entsprechenden Orten erwartbar treffen, muss eingeübt werden. Jede soll sich im Alltag mittels eines eingewanderten wissenschaftlichen Habitus der Distanziertheit und Objektivierung der Anderen immunisieren. Unter diesen Vorzeichen werden die Formen der Vermittlung in der Pornographie und der Didaktik der neuen Lernkultur zur angemessenen Förderung.
Abwesenheit von vertrauten Menschen, Angst vor zu großer, verstörender Lebendigkeit des Anderen, Furcht vor der Einmischung in die inneren Angelegenheiten macht ungeschützte Befriedigung unter Beteiligung nicht distanzierter Anderer beängstigend und generiert ein Feld von Sexualität um die Pornographie herum, das zu mehr als einem Ersatz geworden ist. Es entsteht offenbar eine neue Form von alltäglicher Sexualität, die nicht unbedingt als Surrogat verstanden werden kann. Sie ist eine Erfindung. In ihr tauchen zeitlich limitiert und räumlich distanziert die Anderen auf erträgliche Weise aber effektvoll, sicht- und hörbar auf. Unberührt, es sei denn von sich selbst, und in beiden Richtungen unberührbar ohne Duft und Geruch. Es ist so wie der Vergleich des wirklichen Lebens mit der Didaktik, mit didaktisch strukturierten Situationen: Inhalte erscheinen meist in hochabstrahierter, oft auch rekonkretisierter Art. Als erfahrbare, sinnliche Wirklichkeit sind Lehrer und Schüler sowie die Umgebung zwar Träger der didaktischen Szene (Ausnahme ist das E-Learning), sollten aber zumindest für die Dauer des Unterrichts negiert und in dieser Qualität nicht angerührt werden.
Ein Ausweg wäre der schwierige Versuch, beim Zeigen zu zeigen, dass man nicht alles zeigt, zeigen kann, dass es in dieser artifiziellen Aufbereitung Grenzen gibt, die nur um den Preis von Zerstörung des Settings zu überschreiten sind. Ein solcher Index macht aber möglicherweise Lust, über die didaktische Situation hinauszugehen, auf Trennung vom Unterrichten und vom Lernen, mit Lust, Neugier, Mut zu Wut und Trauer über das Vorenthaltene, um dann woanders hinzukommen. Gleichermaßen könnte auch der Porno animierender sein für Sexualität jenseits der Grenzen des Mediums.
Körper
Augen sind erogene Zonen, reizbar und reizvoll. Sie sind aber keine Öffnung im Sinne von Löchern, nicht wie der Mund, dessen Rand etwas umschließen kann, in den etwas hineingebracht und verschlungen werden kann im konkreten Sinn. – Ödipus macht erst durch seine Selbstblendung – ein Anti-Selfie – im Akt der Zerstörung, könnte man sagen, weitere Körperöffnungen.
In der Pornographie kommt es, was Sehen und Blick angeht, zu einer Verschränkung: Wir sehen auf die Oberflächen unterschiedlich gestalteter Schirme. Das Sehen wird wie immer dort gestoppt. Der Blick penetriert die medialen Oberflächen und sieht inhaltlich dargestellte Öffnungen, die Körperöffnungen beliebiger Nebenmenschen. Und hier kann der Zuschauer über passagere Identifikation oder Einfühlung über das optisch Sichtbare hinausgehen und eindringen oder sich penetrieren lassen. Der durch Erregung offene, sich dadurch exponierende Körper des Zuschauers wird quasi in den Film, in das Bild hineingesogen, dort phantasmatisch in seiner Bedürftigkeit entsorgt, dadurch, dass physisch und psychisch eine Entladung, ein Orgasmus erfolgt, wobei die Berührung in der Phantasie gewirkt hat. Phantasien lassen sich in ihrer Wirksamkeit beobachten. Sie ergreifen den Körper (vgl. dazu Butler 1997 und Settele 2015).
Bis zu dieser Konsequenz kann Didaktik nicht fortschreiten. Der cum shot oder auch money shot oder die bei Frauen indirekteren Zeichen einer Befriedigung werden durch Evaluationsrituale ersetzt.
Die Begehrensstruktur des Blicks wird eingefangen durch eine konkretisierende Antwort, über die Erregung wieder aus dem Bild geschmissen und wieder auf sich selber als Triebkörper zurückgeworfen. Man ist dann wieder ganz bei sich.
Die Begehrensstruktur des Blicks, angereizt durch Menschen und Bilder, vorläufig zu be- ruhigen, gelingt in der Schule nicht so konkret wie in der Pornographie. Die Anspannung der Individuen erhöht sich bei gelingendem Unterricht, sie laden sich auf und schaffen ein brisantes Klima, das – so könnte man hoffnungsvoll sagen – als Potenzial zu Wissbegier und Lernen sublimiert werden kann. Das heißt, dass das brisante Klima kultiviert werden muss. Leibesübungen sind da nur eine Möglichkeit.
Pornographie entsorgt beim Identifizieren und Projizieren frei flottierende sexuelle Strebungen, die beunruhigend wirken. Vom anderen her wie aus der „innersomatischen Reizquelle“ tendiert immer etwas über die Grenze der Individualität. Pornographie gibt den Strebungen eine Richtung, einen Platz. Sie ist beschäftigt mit der Produktion von Berührungsimaginationen auf der Grenze zur Halluzination. Die pornographischen Bilder werden eingesetzt bei Erregung, die schon vorher in Gang gebracht wurde von innen und/oder außen, spülen mit der umwegig, medial vom Anderen kommenden weiteren Erregung körperliche, zum Anderen strebende Spannungszustände weg, so dass sie im Alltag nicht mehr zu sehr stören. Sie entlassen die meist an private Bildschirme und -schirmchen angekoppelten Körper (also nicht mehr Kino) ins Alleinsein und die Illusion eigentlich, autonom und erleichtert, vielleicht auch enttäuscht, mit sich identisch geblieben zu sein. Die Pornographie und die sich aus ihr ergebenden Befriedigungsformen sind nicht mehr mit den realen Seiten einer Beziehung verknüpft.
Selbstoptimierung
Der Funktionswandel der Pornographie wäre nur unzureichend verstanden, wenn man sie als Surrogat verstünde. Sie verhilft zur Entspannung, zur Fitness, auch zur Gesundheit. Sie ist darin dem Sport und allen möglichen Formen von Leibesübungen, der Kontrolle der Nahrung und des Stoffwechsels verwandt. Sie ist irgendwie Bio. Es bleibt aber die Frage, ob gleichzeitig damit auch neue Formen der Sozialität, also der Beziehung zum Anderen entwickelt werden. Die Sexualität ist prinzipiell ein mächtiges Instrument, aus den eigenen Begrenzungen auszusteigen. Deren Struktur wird zum Vor- und Nachbild von Bezugnahme auch anderswo im gesellschaftlichen Leben. Sie ist Stütze für ökonomische und juridische Beziehungen, aber auch Vorschein von für den Moment zweckfreier Beziehung, insofern sie oft Zukunft und Vergangenheit auszublenden anregt.
Die Trennung der Fortpflanzung von der Sexualität eröffnet große Gestaltungsspielräume. Diese sind auch nicht risikofrei, sind anders, ähnlich dem Kitzel der Freude und Bedrohung durch Fruchtbarkeit. Die Gestaltungsspielräume sind dann auf andere Weise fruchtbar. PaulPreciado nennt die Pille in Anspielung auf Foucault allerdings „essbares Panoptikum“ (Preciado 2013: 187). Auf zweierlei Weise ist das in diesem Zusammenhang interessant: Die Pille führt auch in der Mode zunächst zu einer gesteigerten Sichtbarkeit, visuellen Reizen; sie ist aber auch wie das Panoptikum Kontrollinstrument (der Fruchtbarkeit) und derer, die an der Einschränkung der Fruchtbarkeit interessiert sind. Die Pille führt nicht automatisch zu größeren Spielräumen.
Die Gefahren sind nicht alle verschwunden. Es bleiben Viren und Bakterien als Gefahr. Auch vor dieser Berührung kann der Porno schützen.
Grundsätzlich bringt die Entkoppelung von sexueller Lust (in der Heterosexualität) und Nachkommenschaft das Potenzial mit sich, sich von der realen Ökonomie und rechtlichen Bindungen abkoppeln zu können. Sexuell erregende Beziehung hat dann wie (autonome) Kunst und (romantische) Liebe ihre Referenz nur mehr in sich, wird sekundär vermarktet und gleicht sich damit den Derivaten[8] der Finanzindustrie an. Allerdings können Gewinne und Rendite aber auch dort nur in der Realwirtschaft erzielt werden, nicht durch Blasen alleine, sondern in der Verausgabung von Arbeitskraft in Einigung mit Anderen am Material. Vielleicht können Einzelne auch ohne diese Reibung mit dem Realen Gewinne erzielen, mit denen sie Macht ausüben können, nie aber die Ökonomie insgesamt.
Der Eindruck kann entstehen, als ginge es um eine übertragungslose Ökonomie[9], die Etablierung voneinander distanzierter Entitäten, die einzeln optimierbar sein sollen, eine Art perpetuum mobile – im Gegensatz zu einer Ökonomie des Werdens ohne identitäre Gewissheiten. Es gibt eine Verwandtschaft zwischen Pornographie, Derivaten in der Finanzindustrie und dem rationalen Denken. Sie verzichten alle auf ein sinnlich involviertes, fühlendes, sich reibendes Engagement, um das Risiko der Täuschung und Enttäuschung, des verfehlten Vertrauens, der Unterstellungen loszuwerden. Die Veranderung wird durch Selbstidentität bekämpft. In den Pornos erringt sehr oft der Mann wieder die Herrschaft gegen die Veranderung, indem er plötzlich aktiv und klar den Penis aus der Vulva nimmt und draußen ejakuliert, der Sichtbarkeit zugänglich, evaluierbar. Oder befiehlt: „Take it out and watch me come“. Das ist der money shot im Unterschied zum meat shot.
Wirkung
Wirkung bleibt auch beim zwecklosen Sehen nicht aus.
Worin besteht jene magische Kraft der Farbe, jenes einzigartige Vermögen des Sichtbaren, das bewirkt, daß es, in Sichtweite gehalten, doch mehr ist als bloßes Korrelat meines Sehens, daß es mir mein Sehen aufdrängt als Wirkung seiner souveränen Existenz? (Merleau-Ponty 1986: 177f.)
Zumindest im Deutschen ist dieser Satz mehrdeutig. Ich lese ihn so: Das Sichtbare drängt mir mein Sehen auf als Wirkung der Existenz des Sichtbaren – ergänzt: Auch meiner selbst als sichtbare Erscheinung für andere.
Das Sichtbare, inklusive mir selbst, kommt also zurück in Form der Existenz von etwas Anderem. So ist die Aussage auf Pornographie beziehbar. Der Andere ist nicht lediglich das Korrelat meiner Suche, er drängt sich mir auf als Wirkung seiner von mir unabhängigen Existenz, auch als Bild, das sich vom Anderen ablöst und in mich einfällt. Es kommt zu gesuchten, erwünschten Verschränkungen.
Verschränkungen sollen nicht die Verbundenheit aller Wesen als Eins benennen, sondern vielmehr spezifische, materielle Beziehungen der fortwährenden Differenzierung der Welt. Verschränkungen sind Beziehungen der Verpflichtung – dem anderen verbunden sein / an das Andere gebunden sein / Verbindlichkeit – eingefaltete Spuren des Otherings. Othering, die Konstitution eines ‚Anderen‘, bedingt eine Verpflichtung gegenüber dem ‚Anderen‘, das irreduzibel und materiell an das ‚Selbst‘ gebunden ist und es durchwirkt – eine Diffraktion/Dispersion von Identität. ‚Andersheit‘ ist eine verschränkte Beziehung der Differenz (différance). […] Was wäre, wenn wir anerkennen würden, dass Differenzieren eine materielle Handlung ist, bei der es nicht um radikale Trennung geht, sondern im Gegenteil darum, Verbindungen und Verbindlichkeiten zu schaffen? (Barad 2015: 162).
Traum der Pornographie
Die Pornographie scheint klar und deutlich in ihrem Vorgehen und Ziel. Sie hat aber auch Charakteristika eines Traums[10], wie auch Lewandowski ausführt (vgl. Lewandowski 2012: 13ff.). Verdichtung, Verschiebung, Grenze der Darstellbarkeit, sekundäre Bearbeitung. Der Betrachter sieht den manifesten Traum, den jemand anderes auf seinen vermuteten Wunsch hin und zugunsten seines eigenen ökonomischen Interesses produziert hat. Die Pornographie muss wie der Traum vermeiden, was den Schlaf oder die Narkotisierung der Übertragungsstrebungen stören könnte.
Die Neue Lernkultur erzeugt so etwas wie den Traum der Freiwilligkeit und Selbststeuerung, der verhindert, dass der Lehrer nach seiner Präsenz und seinem Begehren gefragt wird, dass ihn die Widerstände und die fast notwendige Aggressivität treffen, die die tatsächliche Fremdbestimmung und das Drängen zur Anerkennung der symbolischen Kastration auslöst, der Anerkenntnis der existierenden Sprachen im weitesten Sinne, die das individuelle Subjekt einschränken. Der Lehrer macht sich überflüssig.
Solche Handlungen, unter didaktischen oder pornographischen Vorzeichen, ohne die unkalkulierbare Präsenz eines Anderen werden durch Appell an den Affekt, dem klare Vorstellungen geboten werden, durchgehalten. Das Sichtbare, die Erfolgserlebnisse, das Abhaken des Erreichten im Kompetenzraster verdecken gnädig Wünsche und Begehren. Die Erregung im Erreichen des Ziels lullt traumhaft ein. Das, was zu sehen ist, kann so für das Angestrebte gehalten werden. Die Erregung bestätigt die Existenz.
Die Pornographie ist ein Traum von wahrscheinlich nicht nur, aber auch sexuellen Beziehungen. Sie ist aber eben ein Traum. Als Manifestes schleppt sie in Abkürzungen, Verdichtungen, Verschiebungen, oft lange bevor die Grenzen der Darstellbarkeit erreicht sind, mit minimalistischen sprachlichen, lautlichen oder musikalischen Begleitungen Latentes mit sich. So ist sie auch die abstrakte Vollendung des romantischen Traums von der freien, sexuellen Beziehung, frei von den verzweckten und vernünftigen Normen als prinzipiell unendliche Variation.
Ist das so anders in gegenwärtigen didaktischen Ausrichtungen des Mainstreams? Der Traum von der Unabhängigkeit des Schülers vom Lehrer, den z. B. Rousseau im Émile träumte, wenn er ihn von den Gegenständen abhängig machen will, nicht aber vom Erzieher.[11] Der Traum von der vollständigen Befreiung von Übertragungsbeziehungen.
Das romantische Konzept hatte nicht die pharmakologische Kontrazeption und damit die Trennung von Sexualität und Fruchtbarkeit als Hintergrund. Sie war anders eingebunden in moralische Normen, die Gefährlichkeit und den Reiz von Verboten. – Hier ist dann auch die Vergleichbarkeit wohl zu Ende. Auf didaktischem Gebiet gibt es noch keine durchgreifende pharmakologische Lösung, wenn man von Ritalin einmal absieht, was man ebenso als „essbares Panoptikum“ mit ruhigstellender Wirkung bezeichnen könnte.
Gegen Übertragung
Pornographie wird wie die Schul- und Universitätsreform, wie die Sparpolitik und die Realabstraktionen des Kapitalprozesses als Bollwerk gegen die Unwägbarkeiten der Übertragung eingesetzt. Übertragung ist in ihren Energien an Singularitäten gebunden. Das bringt Überraschungen, Fremdes, Unbeherrschbares. Pornographie wandelt Libido in eine abstrakte Energieform, wie es der elektrische Strom ist. Sie ist nicht notwendig an Eigenartiges gebunden.[12] Pornographie, so könnte man sagen, ist der Versuch, Beziehungsmodelle vorzuführen, die ohne die Dimension des Begehrens und damit des Symbolischen in Form von Sprechen als eines riskanten, spekulativen Sprechens auszukommen scheinen, bzw. auf ein im Wesentlichen instrumentelles Niveau zurückgeschnitten werden. Narration wird angeklebt, damit die Sprünge über die Absurditäten der Sexualität mit alten Versatzstücken der Motivation aus geläufigen Erzählungen übersprungen werden können.
Auch manche Didaktik lebt vom Traum der beherrschbaren, passgenauen Vermittelbarkeit des Wissens um die Welt. Wird das Traumhafte für direkt realisierbar gehalten, Erfolge unpersönlich herbeigezwungen und nach Möglichkeit zeitnah beweisbar gemacht, d. h. ohne dass erkennbar wird, dass da jemand ist, der für einen Anderen etwas will, ihm etwas unterstellt, was er oder sie haben oder sein könnte, dafür dann auch gerade steht – im übertragenen Sinne natürlich – dann nähert sie sich der Logik der Pornographie.
Logik der Pornographie
Zunächst entferne ich mich nun etwas von dem direkten strukturellen Vergleich zwischen Didaktik und Pornographie, versuche aber, einige, gerade das Mediale betreffende Aspekte zu erwähnen, die für den Fachinhalt der Ästhetischen und Visuellen Bildung interessant sind. Die meiste Pornographie realisiert sich als Video. Abgegrenzte Individualität wird auf der filmischen Ebene dadurch bestärkt, dass genau darauf geachtet wird, dass zwei, drei jedenfalls zählbare Individuen erkennbar bleiben, die nur in partieller Berührung mit Anderen sind. Laute, wie Schnurren, Stöhnen, Minisätze, sind eher Effekte von Handlungen oder möchten diese herbeiführen, als dass sie zu sexuell hergestellter Vermischung im Spannungsverhältnis stünden. Der erfreuliche oder bedrohliche Moment der zeitweiligen Einheit oder gar der orgiastischen Verschmelzung bleibt meist ausgeklammert. Das würde die Sehnsucht des vor dem Bildschirm ausgesperrten Betrachters zu sehr anheizen. Es herrscht ein quasi dokumentarischer Charakter der visuellen Beobachtung mit Atmo, eine Art Aufklärungsfilm – schon wegen des Filmens muss es ja relativ hell bleiben bei Billigproduktionen – mit körperlich berührungsloser Beteiligung des Adressaten. Es soll nichts verborgen bleiben. Unverborgenheit ist der Heidegger’sche Ausdruck für Wahrheit (Heidegger 1931/32: 19). Die Hüllen fallen. Die Spaltung von Auge und Blick wird reduziert. Das Objekt sieht mich nicht von einem verborgenen Punkt aus an, nicht so, dass das Sehen ahnt, dass da etwas auf dem Weg ist anzublicken, intensiv zu wünschen, zu begehren. Öfter blicken die Darsteller direkt in die Kamera, was in der Regel in anderen Filmen ein absoluter faux pas wäre. Der Zuschauer wird zum direkten Adressaten. Fotos und Filme sind so eingerichtet, dass mit dem Zuschauer als Objekt des Films etwas passiert.
Ganz draußen bleibt er nicht, stattdessen muss er sich in den Film einnähen, damit z. B. die Schnitte funktionieren. Das tut der Betrachter über das je eigene Körpergefühl als Kompensation dafür, dass nur eine oberflächliche Hülle ohne körperliche Volumina und haptische Reize sichtbar wird. Die Haltung des Zuschauers ist dabei irgendwo zwischen imaginierter Interaktivität und sich zum stillhaltenden Objekt machender Interpassivität, welche die Anderen das tun lässt, wozu man selber keine Lust hat oder keine Möglichkeit sieht. Voyeurismus.
Ikonische Differenz
Umso mehr muss Pornographie in Foto und Film versuchen, über die visuelle Wahrnehmung Zugang zu den anderen Sinnen und dem körperlichen Empfinden zu bekommen. Erreicht wird das oft durch eine Perspektivierung, die über zeitweilige, auch wechselnde Identifikationen eine möglichst umfassende Erregung übers Imaginäre mit Körperanschluss bewirkt. Das setzt dann einen sich verselbständigenden körperlichen Prozess in Gang, der die Abstraktion verkraften hilft, durch die Konkretion der Entlastung vom Triebdruck. Das gelingt, weil für eine Zeit die reale Anwesenheit des Anderen als bedrohlich oder irritierend, die Autonomie als gefährdend ausgeschlossen wird.
Genitalien – Idealbildung – Schönheit
Was wird gezeigt bei der Pornographie? Unvermeidlich irgendwann und direkt Genitalien. Nun sind Genitalien selbst, so schreiben Freud und viele Andere, selten direkt als „schön“ empfunden worden. Sie werden erst schön mit der Erregung, also wenn man erst einmal in Fahrt kommt. – Das ist oft mit Unterrichtsinhalten, speziell mit Bildender Kunst nicht viel anders. – Um das Schönwerden sicher zu stellen, gibt es zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Formen Beschneidungen (Bettelheim 1975: 121ff.).[13] Versuche der Vereindeutigung auch der Differenz der Geschlechter mit allerlei Nebeneffekten. Gegenwärtig nehmen die schönheitschirurgischen Eingriffe an den Genitalien im Erwachsenenalter deutlich zu, um einem fiktiven Ideal hinterher zu operieren. Die Pornographie wäre in dieser Hinsicht fast ein Äquivalent zur Beschneidung, auch in ihrer symbolischen Funktion.
Die statische, als Eigenschaft angezielte Verschönerung der Genitalien und des Drumherums nehmen als Ergebnis den Prozess gegenseitigen Sich-schön-Machens (nicht nur des Schöntrinkens) durch wechselseitige Unterstellungen, Verführungen vorweg. Man hat es mit einer offenbar durchschnittlich gesellschaftlich erwünschten Vorabverbesserung zu tun. So müssen das Andere, Gegenstand oder Mensch, nicht erst noch durch Austausch und Übertragung zu dem werden, was begehrt wird und nie als etwas Beherrschbares zu erreichen ist. Es wird so einem identitären Essentialismus gefrönt. Dinge und Personen sind so und als solche attraktiv oder nicht.
Sehen, Erregung, Handlung im zielführenden und zeitnahen Kurzschluss. Es fällt das anregende, verführerische Vorspiel aus, das unter anderem die Funktion hat, den oder die Anderen jeweils attraktiv oder begehrenswert schön oder schöner zu machen, dem entsprechend gibt es auch kein Nachspiel.
Ohne es so zu explizieren, ist Freud mit den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie auf dem Weg zu einer anderen Ontologie (Freud 1905a). Freud schreibt auf den ersten Blick hoch widersprüchlich: „Es scheint mir unzweifelhaft, daß der Begriff des ,Schönen‘ auf dem Boden der Sexualerregung wurzelt und ursprünglich das sexuell Reizende (,die Reize‘) bedeutet. Es steht im Zusammenhange damit, daß wir die Genitalien selbst, deren Anblick die stärkste sexuelle Erregung hervorruft, eigentlich niemals ,schön‘ finden können.“ (Ebd: 66)
Da Genitalien erst schön gemacht werden und das Freud zufolge durch die sexuelle Erregung geschieht, die von den Genitalien ausgeht, geht dies nur über Wunschbilder vielleicht auch mit herausfordernden Hindernissen oder zeitlichen Verzögerungen. Diese überschreiten das, was gerade wahrzunehmen ist, aber nur dadurch, dass es wahrnehmbar ist. Erregung wird erst, wenn vorausgesetzt wird, dass die Attraktivität nicht alleine von der Schönheit eines isolierten Objektes abhängig ist, nicht nur vom unmittelbaren visuellen Eindruck. Eine gleichzeitige innere Bewegung, meist angestoßen von Anderen, springt über, gespeist von vorangegangenen äußeren Reizen, von Phantasien, die die verschiedenen Momente koppeln, wirksam werden. So werden sie auch für Andere in Erscheinung, Geruch, Gefühl, Geschmack und Gehör gebracht. Der Prozess der Erregung, Aufregung, Neugier, Sehnsucht verändert das handelnde Subjekt, nicht nur an den Genitalien. Objekte gestalten Subjekte und umgekehrt, sie werden sogar erst abgrenzbar durch die Bewegung und den häufig auftretenden Wunsch danach, dass die Differenz verschwinde und Unmittelbarkeit entstünde. Prozesse sind offenbar die begehrten Objekte mit all den kleinen Entscheidungen und Risiken, die z. T. auch unbewusst getroffen werden. Sie stellen die Attraktivität erst her.
Die schönheitschirurgischen Eingriffe an allen möglichen Körperteilen und Idealisierungen – auch im Pornofilm – sind Rettungsversuche einer alten Ontologie: Ein Objekt ist, wie es ist; es hat Eigenschaften, die Eigenschaften wirken kausal und kausal wird auf sie eingewirkt. Ebenso identisch und identifizierbar wird das individuelle Subjekt – nicht wirklich.
Nimmt man den Satz Freuds etwas oberhalb im Text der „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ (1905) dazu, wird der Eindruck verstärkt, dass er an die Grenzen der damaligen naturwissenschaftlichen Denkweise stößt. „Der optische Eindruck bleibt der Weg, auf dem die libidinöse Erregung am häufigsten geweckt wird und auf dessen Gangbarkeit – wenn diese teleologische Betrachtungsweise zulässig ist – die Zuchtwahl rechnet, indem sie das Sexualobjekt sich zur Schönheit entwickeln lässt.“ (Ebd.: 66) Der zunächst auf dem Hintergrund deutscher Geschichte irritierende Ausdruck „Zuchtwahl“ ist direkt von Darwin übernommen. Eine aufgrund von Attraktion und Erregung getroffene Wahl, mit dem Spaltprodukt Trauer, lässt Schönheit entstehen, ein Prädikat der Bejahung, der Anerkennung. Dieses fließt in die nächsten Generationen ein, hat einen Effekt über lange Zeiträume, relativ ewig sogar.
„Die mit der Kultur fortschreitende Verhüllung des Körpers hält die sexuelle Neugierde wach, welche danach strebt, sich das Sexualobjekt durch Enthüllung der verborgenen Teile zu ergänzen, die aber ins Künstlerische abgelenkt (,sublimiert‘) werden kann, wenn man ihr Interesse von den Genitalien weg auf die Körperbildung im ganzen zu lenken vermag. Ein Verweilen bei diesem intermediären Sexualziel des sexuell betonten Schauens kommt in gewisser Weise den meisten Normalen zu, ja es gibt ihnen die Möglichkeit, einen gewissen Betrag ihrer Libido auf höhere künstlerische Ziele zu richten.“ (Ebd.)
Es ist dies das zweite Mal, dass Freud in seinen Arbeiten von Sublimierung spricht (Menninghaus 2007: 242)[14]. Sublimierung beinhaltet einen merkwürdigen Sprung. Überraschenderweise wird ein Aggregatzustand übersprungen. Solche Sprünge kennzeichnen auch Bildungsprozesse. Dabei bleibt etwas unsichtbar.
Davor werden gewisse intermediäre (auf dem Wege zur Begattung liegende) Beziehungen zum Sexualobjekt, wie das Betasten und Beschauen, als vorläufige Sexualziele anerkannt. Diese Betätigungen sind einerseits selbst mit Lust verbunden, andererseits steigern sie die Erregung, welche bis zur Erreichung des endgültigen Sexualzieles andauern soll.
Intermediäres ist ganz allgemein gesprochen die Herausforderung zur weiteren Formulierung, zu Form- und Materialveränderungen. Daran arbeitet auch Kunst. Das, was auf dem Weg liegt, kann dann zum vorläufigen Ziel werden. Auch zum Substrat von Perversion. Freud versucht, die alte ontologische Konstruktion noch zu retten, indem er die sekundären Geschlechtsmerkmale ins Spiel bringt, die für schön gehalten werden. Er gerät damit aber in eine petitio principii.
Die dem Sexualobjekt vielleicht entlegenste [erogene Zone, KJP], das Auge, kommt unter den Verhältnissen der Objektwerbung am häufigsten in die Lage, durch jene besondere Qualität der Erregung, deren Anlass wir am Sexualobjekt als Schönheit bezeichnen, gereizt zu werden. Die Vorzüge des Sexualobjektes werden darum auch ,Reize‘ geheißen. Mit dieser Reizung ist einerseits bereits Lust verbunden, andererseits ist eine Steigerung der sexuellen Erregtheit oder ein Hervorrufen derselben, wo sie noch fehlt, ihre Folge. (Freud 1905a: 114)
Der Trieb, jenes Grenzgeschehen zwischen Seelischem und Körperlichem, lässt die der visuellen Wahrnehmung sicheren Grenzen dahinschmelzen und stellt neue Anforderungen ans Denken, Fühlen und Handeln.
Die Grenzen der Sichtbarkeit
Der Mensch hat im wahrsten Sinne die Offenheit, jenes Zuviel an Zuwenig, eine mehr oder weniger nackte Haut, die je nach Stimmung, Tages-, Nacht- und Jahreszeit verkleidet werden kann. Verhüllung reizt zu Enthüllung, wenn denn der Reiz einmal aufgekommen, erinnert und phantasiert wird. Ausgehend vom Sichtbaren beleben Ergänzungen, Vermutungen und Extrapolationen die Vorstellungskraft. Hier beginnt das Imaginäre richtig zu arbeiten. Verhüllung und Enthüllung zugleich.[15]
Die Offenheit wird auch erzielt durch Verdrängung. Freud spricht in Bezug auf den Geruchsinn von der „organischen Verdrängung“.[16] Das ermöglicht andere Kombinationen, von Sehen, Tasten, Riechen, denn der Geruchssinn muss beim Menschen anders aktiviert werden, kann unterschiedliche „Geruchsbilder“ aufnehmen. Es kann zu Täuschungen kommen, mutwillig herbeigeführten falschen Kombinationen. Schönheit kann mit Betrug und Geheimnis verbunden werden. Es entstehen leicht paranoide Züge.
[…] der sich künstlich Ornamentierende muss nunmehr ein Experte für die Präferenzen des anderen Geschlechts [oder desselben, des kombinierten oder wechselnden, KJP] sein. Sonst wäre sein Aufwand nutzlos […]. Künftig müssen die sexuellen Wesen sich stets auch selbst genauso so zu beobachten lernen, wie sie vom anderen Geschlecht beobachtet werden. (Menninghaus 2007: 204)
Es geht dabei nicht nur um ein auf Fakten ausgerichtetes Sehen. Subvertiert wird das Wahrnehmen durch den Blick. Mit diesem kann Schönheit allerlei merkwürdige Erscheinungsformen ausbilden, die nach konventioneller Überzeugung eher von Ekel (vgl. Pazzini 2015a) sind. Auch dieser bietet die besondere Chance, die eigene Abgeschlossenheit und die des anderen zu überwinden – über sogenannte „Perversionen“. All das kann schiefgehen.
So müsste man sich denn vielleicht mit dem Gedanken befreunden, daß eine Ausgleichung der Ansprüche des Sexualtriebes mit den Anforderungen der Kultur überhaupt nicht möglich ist, daß Verzicht und Leiden sowie in weitester Ferne die Gefahr des Erlöschens des Menschengeschlechts infolge seiner Kulturentwicklung nicht abgewendet werden können. Diese trübe Prognose ruht allerdings auf der einzigen Vermutung, daß die kulturelle Unbefriedigung die notwendige Folge gewisser Besonderheiten ist, welche der Sexualtrieb unter dem Drucke der Kultur angenommen hat. Die nämliche Unfähigkeit des Sexualtriebes, volle Befriedigung zu ergeben, sobald er den ersten Anforderungen der Kultur unterlegen ist, wird aber zur Quelle der großartigsten Kulturleistungen, welche durch immer weitergehende Sublimierung seiner Triebkomponenten bewerkstelligt werden. (Freud 1912: 199f.)
Durch immer mehr Sichtbares, wird das Unsichtbare immer mächtiger und wohl bei der Prävalenz des Sehens fast unbemerkbar. Deshalb nimmt das Hören in der Psychoanalyse einen so großen Stellenwert ein.
Totale Sichtbarkeit
Die eigentlich sehr gewitzte Arbeit von Sven Lewandowski wartet wie viele andere Erörterungen von Pornographie mit einer falschen Voraussetzung auf: „Die zeitgenössische (Hardcore-) Pornographie zeigt buchstäblich alles und zwar in unverstellter Weise, während für Träume Uneindeutigkeit und Verworrenheit charakteristisch sind.“ (vgl. Lewandowski 2012: 15).
Der Porno verdankt sich hingegen der Unsichtbarkeit. Und zugleich gibt er etwas zu sehen, was alltäglich so nicht zu sehen ist. Er richtet sich an Individuen, die schon immer und immer wieder, auch wenn sie in sexuell tätigen Beziehungen leben, zu wenig an Sexualität gesehen haben bei der Berührung, keine Artikulation dafür finden können oder sich trauen zu finden. Bei der pornographischen Vorführung bleibt Unsichtbarkeit bestehen, die Unsichtbarkeit dessen, was die Anderen sind, was von Anderen ausgeht, wie es im Anderen wirkt. Viele Sexualpraktiken leben davon, dass oft in der Nähe des Höhepunktes Sichtbarkeit schwindet und die Trennung separierbarer, individueller Entitäten zeitweise aufgehoben wird – vielleicht im Hegel’schen Sinne.
Neugier ist stark vom Sehen-Wollen getrieben, auch wenn das zunächst weder Ziel oder Objekt war. Oft verselbstständigt sich die Lust an der Enthüllung.[17] Unsichtbarkeit in Bezug auf die Fremdheit bleibt bestehen. Das Fremde des Anderen weicht nicht, kann vielleicht durch Vertrauen überbrückt werden. Im Kontrast zur Nacktheit kann Unsichtbarkeit sogar größer werden, gerade bei momentaner Entspannung. In der Struktur der Pornographie wird autosuggestiv zu lernen versucht, dass durch immer mehr Sichtbarkeit und immer mehr sichtbar Gemachtes vielleicht doch noch Befriedigung erreicht werden kann. Dieser Abstraktionsvorgang ist der klassische Mechanismus, der zur Sucht führen kann: Mehr vom zuhandenen, herstellbaren oder herbeiführbaren Gleichen. Der Hiatus zwischen Sichtbarem und Unsichtbaren wächst, wenn das Sichtbare vorgibt, alles zu sein. Es gilt, sich zu trauen, das wahrzunehmen. Auch in den Entdeckungen des Lernens im Unterricht ist das kaum anders zu haben: Deutlich Sichtbares kann verdecken, dass Relationen nie direkt sichtbar sind. Sichtbare Zusammenhänge, schematische Darstellungen lassen – und das ist ja auch ihr Sinn – Komplexität verschwinden. Gute Didaktik und gute Pornos zeichnen sich wohl dadurch aus, dass sie Indizes dafür enthalten, dass etwas verborgen, geheimnisvoll, rätselhaft bleibt, sich das Abgebildete nicht für das Unverborgene hält.
Didaktik produziert keine Sackgasse und ist dann nicht inzestuös, wenn ein Begehren die Situation übersteigt, zeitlich, räumlich, inhaltlich und personal. In der je aktuellen Situation ginge es dann um momenthaft stützende und weitertreibende Anerkennung und Befriedigung. Hier und jetzt ist eben nicht alles möglich. Das ist eine der möglichen Übersetzungen des Inzestverbotes.
Aufgezeigt werden sollten strukturelle Ähnlichkeiten zwischen (Mainstream-)Pornographie und (Mainstream-)Didaktik. Die hier befragte Pornographie wie auch Didaktik sind politisch gewollt. Sie wirken sedierend. In den strukturellen Ähnlichkeiten wird Berührung abgewehrt, letztlich Übertragung. Es geht nicht um dieses oder jenes didaktische Modell, sondern um den Zug der Anerkenntnis der pädagogischen Paradoxa (siehe z. B. Wimmer 2014) als solche, die nicht zur Unmöglichkeitsvorstellung, aber auch nicht zur technokratischen Lösung führen, der Erfolge wie der cum shot zum Coitus interruptus führen. Für diesen gibt es die Umschreibung, dass der Lehrer ein Moderator von Unterrichtsprozessen sei. Er halte sich also letztlich raus. Eine Ähnlichkeit von Pornographie und Didaktik lässt sich erkennen als Tendenz einer unaufdringlichen, nicht direkt invasiven Kontrolle, im Moment der Gouvernementalität: Freiwilligkeit dessen, was zu tun ist, im Sinne einer ungefährlichen, d. h. berührungslosen, nicht kontaminierenden Kontaktaufnahme. Kontakt bringt Komplikationen mit sich. Die Komplikationen ergeben sich aus der Öffnung, der eigenen, aktiv und passiv, und der anderen, aktiv und passiv. In der Didaktik kommt noch dazu die Verantwortung für die Auswahl der Inhalte durch eine ältere Generation, die nicht wissen kann, was in zehn oder zwanzig Jahren wichtig wäre. Gegenstand des Unterrichts kann so nur das werden, was das Etikett trägt: Ich als Angehöriger einer (tatsächlich oder logisch) älteren Generation, stehe dafür ein, dass es wichtig ist, dass jemand das erfährt. Es geht um ein methodisch kultiviertes Belieben im wörtlichen Sinn. Dabei bleibt man etwas schuldig. Es bleibt zumindest ein Rest an Unbegründbarkeit und Verfehlen der je singulären Schüler, aber auch der Eigenheiten des Gegenstandes. Und die Freiwilligkeit kann, wie beim erotischen und sexuellen Kontakt, nicht durch umfängliche Vertragsverhandlungen und Prognosen ermittelt werden. Agiert man in diesem Feld als autonomes, sich im Griff habendes, kontrolliertes Individuum, ist man aufgeschmissen. Schuld und Verantwortung lässt sich säkular nur tragen durch ein soziales Band (vgl. Rouzel 2012), dh. einen Diskurs, nicht aber durch Berührungslosigkeit oder nur Selbstberührung. Schon die Effekte des Sprechens im Diskurs verändern die Anderen und den Sprecher selbst. Insofern gibt es insbesondere in der Kunstpädagogik den Gegenstand nur performativ, nicht präexistent. Und er wird die Farbe der Lehrer und Schüler annehmen. Er wird zu dem gemacht, was er ist, durch Lehrer und Schüler, nicht nur vor dem Bildschirm.
Paradoxa zwischen Freiheit und Zwang, die Tatsache, dass jeder etwas schuldig bleibt, den anderen (zum Glück) nie genau trifft, brauchen einen Einsatz von Inhalten, Lebenszeit und Kraft, weil nur so Energie vermehrt werden kann, durch Verausgabung.
Anmerkungen
[1] Dass der „Trieb“ nicht innen ist, war eine spätere Erkenntnis. Der Trieb als die Grenze zwischen Psyche und Soma verstanden, artikuliert sich sozial, das er als Repräsentation dieser Grenze auf Symbolisierungsmöglichkeiten angewiesen
[2] Es gibt natürlich die Pornographie nicht, auch nicht die Im Folgenden operiere ich mit einem ungenauen, problematischen Begriff der Mainstream-Pornographie, wie sie etwa bei youporn und ähnlichen Portalen kostenfrei abgerufen werden kann. Es bedürfte umfänglicherer Erörterung der unterschiedlichen Arten der Pornographie.
[3] „… die psychische Repräsentanz einer kontinuierlich fließenden, innersomatischen Reizquelle … Trieb ist so einer der Begriffe der Abgrenzung des Seelischen vom Körperlichen“.
[4] Wenig gefunden habe ich zur Verbindung von Kunstpädagogik/-didaktik und Pornographie: Eine Magisterarbeit an der LMU München von 1997 beschäftigt sich damit (vgl. Shaw 2015). Die Studierenden dort veranstalteten im August 2015 einen Clubabend zum Thema, interdisziplinär: https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/medien/mum/artikel_mum/host_club_porn.html [12.08.16]; Es gab eine Podiumsdiskussion in Kooperation mit dem Institut für Kunstpädagogik und Kunstgeschichte ab Juni 2015 in München zum Thema „Spannungsfeld – Erotik in der Kunst“ https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kulturreferat/Museen-Galerien/Kunstarkaden/Archiv-2015/arkadenale-piep.html [12.08.16], bei der auch Pornographie thematisiert wurde. – Helmut Hartwig spricht in einem Vortrag vom Zusammenhang zwischen Normalität und Pornographie: „Normalität ist vorbereitete Ihr Vorhandensein entlastet von der Anstrengung der Selbsterzeugung“ (vgl. Hartwig 2008). Einschmelzung der Distanz, Herstellung von Brauchbarkeit der Bilder; (vgl. auch Dorner, Birgit 1999: 215).
[5] Es sind immer, wenn nicht ausdrücklich anders betont, die verschiedenen Formen von Sexuierung mitgemeint, die sich sicher nicht in der Heteronormativität erschöpfen.
[6] Mit dem Aufkommen der Photographie, dann des Films, der Videographie, des Internets wird deren Tauglichkeit mittels Pornographie.
[7] Nebenbemerkung: Es gibt nach wie vor auch Gruppierungen mit dauerhafter Mitgliedschaft. Sie sind oft Auslaufmodelle, wie die großen Volksparteien, oder sie sind autoritär und verlangen die Negation von anregender und beängstigender Fremdheit durch dogmatischen Dazwischen entwickeln sich jedoch viele neue Formen der Gesellung.
[8] Derivate insbesondere in der Form von Futures und Swaptionen sind Versuche der Finanzindustrie, rein aus Differenzen Kapital zu schlagen, um von der Bindung an das Reale des Wirtschaftens wegzukommen. Insofern sind sie Ausweis der Wirkmächtigkeit des Imaginären in enger Verbindung mit dem Einiges wird deutlicher auch bei Mason 2016: 55f.
[9] Hier im Sinne einer globalisierten wie psychoanalytischen Ökonomie.
[10] „Die Intensität der Elemente hier [im Traum, KJP] hat mit der Intensität der Elemente dort [des Materials, KJP] nichts zu schaffen; es findet zwischen Traummaterial und Traum tatsächlich eine völlige ‚Umwertung aller psychischen Werte‘ Gerade in einem flüchtig hingehauchten, durch kräftigere Bilder verdeckten Element des Traums kann man oft einzig und allein einen direkten Abkömmling dessen entdecken, was in den Traumgedanken übermäßig dominierte.“ (Freud 1972: 235).
[11] Bourdieu/Passeron: „Die Ideologien der PA [pädagogischen Aktion, KJP] als einer gewaltlosen Aktion – handele es sich nun um die sokratischen oder neosokratischen Mythen eines weisungslosen Unterrichts, die rousseauistischen Mythen einer natürlichen Erziehung oder die pseudofreudianischen Mythen einer nicht-repressiven Erziehung – zeigen die Gattungsfunktion der pädagogischen Ideologien in ihrer klarsten Form, indem sie […] dem Widerspruch zwischen einer objektiven Wahrheit der PA und der notwendigen (unvermeidbaren) Vorstellung dieser willkürlichen Aktion als einer notwendigen (,natürlichen‘) aus dem Wege gehen.“ (Bourdieu/Passeron 1973: 22f.).
[12]Die Energieform des elektrischen Stroms ist nicht ganz weit weg von Freuds Vorstellung der frei verfügbaren Energie durch Sublimation.
[13] Zur Beschneidung und deren Zusammenhang zur Bildung siehe auch Pazzini 2015b: 145-164.
[14] Menninghaus meint, es sei das erste Mal. Die wahrscheinlich erste Erwähnung findet sich bei Freud 1905b, S.125, 181, 183, zwar im gleichen Jahr publiziert, in wesentlichen Zügen 1901 fertiggestellt.
[15] Maryam Tafakory: Taklif. B3 Biennale of the Moving Image (2015). Online: http://www.blinkvideo.de/index.php?label=selected_show&page=screening_74_uk.xml [26.02.17].
[16] „Ganz allgemein möchte ich die Frage aufwerfen, ob nicht die mit der Abkehrung des Menschen vom Erdboden unvermeidlich gewordene Verkümmerung des Geruchssinnes und die so hergestellte organische Verdrängung der Riechlust einen guten Anteil an seiner Befähigung zu neurotischen Erkrankungen haben kann. Es ergäbe sich ein Verständnis dafür, daß bei steigender Kultur gerade das Sexualleben die Opfer der Verdrängung bringen muß. Wir wissen ja längst, welch inniger Zusammenhang in der tierischen Organisation zwischen dem Sexualtrieb und der Funktion des Riechorgans hergestellt ist.“ Freud 1909d, S. 102.
[17] Unpacking-Videos auf youtube sind Echo davon.
Literatur
Barad, Karen (2015): Verschränkungen. Berlin: Merve.
Bettelheim, Bruno (1975): Die symbolischen Wunden: Pubertätsriten und der Neid des Mannes. München: Kindler.
Bourdieu, Pierre/Passeron, Jean-Claude (1973): Grundlagen einer Theorie der symbolischen Gewalt. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Butler, Judith (1997): Körper von Gewicht: die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Dorner, Birgit (1999): Pluralismen-Differenzen: Positionen kunstpädagogischer Frauenforschung in Deutschland und in den USA seit dem Ende der 60er Jahre. Münster: LitVerlag.
Ferrari, Federico/Nancy, Jean-Luc (2006): Die Haut der Bilder. Zürich, Berlin: diaphanes. Freud, Sigmund (1900): Die Traumdeutung. Gesammelte Werke. Frankfurt/M.: Fischer. Bd. II/III. 4. Aufl.
Freud, Sigmund (1905a): Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. In: Studienausgabe. Frankfurt/M.: Fischer. Bd. 5, S. 37-145.
Freud, Sigmund (1905b): Bruchstück einer Hysterie-Analyse. In: Mitscherlich, Alexander/ Richards, Angela/Strachey, James (Hrsg.): Studienausgabe. Frankfurt/M.: Fischer. Bd. VI, S. 83-186.
Freud, Sigmund (1909d): Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose. Studienausgabe. Frankfurt/M.: Fischer. Bd. 7, S. 379-463.
Freud, Sigmund (1912): Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens. II. Über die Allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens. Studienausgabe. Frankfurt/M.: Fischer. Bd. 8, S. 197-209. Freud, Sigmund (1920): Jenseits des Lustprinzips. Studienausgabe. Frankfurt/M.: Fischer. Bd. 3, S. 213-272.
Freud, Sigmund (1915): Triebe und Triebschicksale. Studienausgabe. Frankfurt/M.: Fischer. Bd. 3, S. 75-102.
Giel, Klaus (1969): Studie über das Zeigen. In: Bollnow, Otto Friedrich (Hrsg.): Erziehung in anthropologoscher Sicht. Reihe Bilden und Erziehen. Zürich: Morgarten. S. 51-75.
Hartwig, Helmut (2008): Kunst und Normalität. Online: http://www.dgae.de/wp-content/uploads/2008/09/Helmut_Hartwig.pdf [12.08.16].
Heidegger, Martin (1997 [1931/32]): Vom Wesen der Wahrheit). Frankfurt/M.: Klostermann, 8. Auflage.
Herz, Marion (2005): PornoGRAPHIE. Eine Geschichte (Promotionsschrift München: Ludwig-Maximilians-Universität. Online: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/8740/1/Herz_ Marion.pdf [02.01.2017].
Lacan, Jacques (1978): Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Seminar XI (1964-1965). Übers. Haas, Norbert. Olten: Walter.
Lewandowski, Sven (2012): Die Pornographie der Gesellschaft: Beobachtungen eines populärkulturellen Phänomens. Sozialtheorie. Bielefeld: Transcript.
Loick, Daniel (2015): General Sex. Über „Testo Junkie“ von Paul B. Preciado. In: Texte zur Kunst. 25. Jg., Heft 98, S. 186-191.
Mason, Paul (2016): Postkapitalismus. Grundrisse einer kommenden Ökonomie. Übers. Gebauer, Stephan. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Menninghaus, Winfried (2007): Das Versprechen der Schönheit. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Merleau-Ponty, Maurice (1986 [1964]): Das Sichtbare und das Unsichtbare. München: Fink. Moulton, Ian Frederick (2000): Before pornography: erotic writing in early modern England.
Studies in the history of sexuality. Oxford England, New York: Oxford University Press. Pazzini, Karl-Josef (2015a): Ekel in der Übertragung. In: RISS – Zeitschrift für Psychoanalyse. Freud-Lacan. 82. Jg., S. 29-52.
Pazzini, Karl-Josef (2015b): Gewalt in Bildung. Notizen zur Beschneidungsdebatte. In: Bilstein, Johannes/Ecarius, Jutta/Ricken, Norbert/Stenger, Ursula (Hrsg.): Bildung und Gewalt. Wiesbaden: Springer, S. 145-164.
Pazzini, Karl-Josef (1999): Über Medien, das Zeigen und das Deuten. Bilder als Nähmaschinen für das fragmentierte Subjekt. In: Hampe, Ruth (Hrsg.): Kunst, Gestaltung und Therapie mit Kindern und Jugendlichen. Bremen: Universität Bremen. S. 58-71.
Prange, Klaus (1995): Über das Zeigen als operative Basis der pädagogischen Kompeten In: Bildung und Erziehung. Bd. 48, Heft 2, S. 145-158.
Preciado, Paul B. (2013): Testo junkie: sex, drugs, and biopolitics in the pharmacopornographic era. New York, NY: The Feminist Press at the City University of New York.
Rouzel, Joseph (2012): Letztlich, es gibt nur das, das soziale Band. In: RISS – Zeitschrift für Psychoanalyse. 77. Jg., S. 29-43.
Settele, Bernadett (2015): Queer Art Education. In: Meyer, Torsten/Kolb, Gila (Hrsg.): What’s Next? – Art Education. Ein Reader. Berlin: Kadmos, S. 308-312.
Sigusch, Volkmar (2008): Geschichte der Sexualwissenschaft. Frankfurt/M., New York: Campus-Verlag.
Shaw Dorothea: Helmut Newton. Mode, Kunst, Pornographie? Online: https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/medien/mum/artikel_mum/host_club_porn.html [12.08.16].
Wimmer, Michael (2014): Pädagogik als Wissenschaft des Unmöglichen. Bildungsphilosophische Interventionen. Paderborn: Schöningh.
 Abb. 1-4: Workshop Situation.
Abb. 1-4: Workshop Situation. Abb. 2
Abb. 2 Abb. 3
Abb. 3 Abb. 4
Abb. 4