Kritisch denken und handeln an einer (Kunst-)Universität. Über die gemeinschaftliche Verkörperung von Kritik in einem vielleicht unterbeleuchteten kunstpädagogischen Feld
„Der Aufbau einer Gemeinschaft erfordert ein wachsames Bewusstsein für die Arbeit, die wir ständig leisten müssen, um unsere gesamte Sozialisierung zu hinterfragen, denn sie bringt uns dazu, uns auf eine Weise zu verhalten, die die Vorherrschaft aufrechterhält.“ (hooks 2024: 58)
An (Kunst-)Universitäten wird studiert, gelernt, gelehrt, verwaltet und geforscht. Universitäten, und speziell Kunstuniversitäten, kommt neben dem Anbieten von Studien und der Beteiligung am wissenschaftlichen und künstlerischen Diskurs die grundsätzliche Aufgabe zu, „Wissen zu analysieren, zu hinterfragen und kreativ zu rekombinieren“ (Bast 2019: 22). In dieser Aufgabe liegt nicht zuletzt jene enorme Verantwortung, die die (Kunst-)Universitäten im gesamtgesellschaftlichen Gefüge innehaben. Diese Verantwortung zu tragen, verlangt ihnen eine „Arbeit“ ab, die es allererst ermöglicht, gegebene Ordnungen des Wissens, aber auch des Handelns, nicht weiter zu erhalten, sondern abzubauen. Auf eine künftige Gemeinschaft, die bereit ist, eine solche Arbeit zu leisten, die eine genuin kritische im Sinne einer zerlegenden, abwägenden und mit Blick auf den jeweiligen Kontext schließlich neu konstruierende Arbeit ist, hofft das diesen Beitrag eröffnende Zitat bell hooks‘. Die Arbeit, die besonders auch (Kunst-)Universitäten zu leisten haben, würde ihrer Ansicht nach nicht nur kritische Operationen beinhalten, die das oben genannte Analysieren und Hinterfragen inkludieren; sie würde auch über das gestalterische Moment des kreativen Kombinierens hinausgehen. Eine solche Arbeit müsste nämlich Hand in Hand gehen mit dem Aufbau einer Gemeinschaft – einer Gemeinschaft, die vielleicht nicht primär, aber auch an (Kunst-)Universitäten entstehen kann.
bell hooks zählt nicht nur zu den engagiertesten diskriminierungskritischen Denker*innen ihrer Generation, sie gilt auch als herausragende Pädagogin. Entsprechend ihrer Leidenschaft, ja, ihrer Liebe für das Lehren widmet sie sich in ihren Abhandlungen immer wieder den Möglichkeiten des pädagogischen Handelns im institutionellen Rahmen von Bildungseinrichtungen und im Speziellen von Colleges und Universitäten. Das Unterrichten ist für sie im Sinne einer Praxis der Freiheit (Freire 1998) zentral für das Hineinwirken in die Gesellschaft mit dem Ziel, herrschende Rassismen, Sexismen und Klassismen in Frage zu stellen, also gegebene Vorherrschaften abzubauen. Das Hinterfragen „unsere[r] gesamte[n] Sozialisierung“ (hooks 2024: 58) deutet auf den Aktionsraum einer Kritik, die ich im Folgenden als „gemeinschaftliches Projekt“ (ebd.: 103) einer Hoffnung auf die Beendigung von Diskriminierung in den Fokus rücken möchte. Obwohl eine solche Kritik als „Arbeit“ bezeichnet wird, ist sie nicht nur als eine Anstrengung und Abwendung vom zu Hinterfragenden verstanden, sondern ebenso als eine Zuwendung zu alternativen Praxen des Zusammenlebens. Nicht umsonst steht hier daher die Gemeinschaft an zentraler Stelle des Kritisierens der bestehenden Ordnung: Sie wird nämlich nicht nur adressiert als das Ziel kritischer Bemühungen, sie wird auch performiert als die Verständigung mit anderen im (Streit-)Gespräch, in der Diskussion, im Diskurs und, eben, im Unterrichten.
bell hooks‘ Idee einer ständig zu leistenden Arbeit einer künftigen, also im Arbeiten entstehenden und wachsenden Gemeinschaft bietet mir im Folgenden einen Einsatzpunkt, um kritisches Denken und Handeln an einer (Kunst-)Universität zu reflektieren. Ich werde mich zu diesem Zweck an dem im Rahmen eines Masterseminars und einer Tagung zum Thema „Kritik (in) der Kunstpädagogik“ im Wintersemester 2022/23 vollzogenen kunstpädagogischen Denk- und Handlungsraum an der Universität Mozarteum Salzburg beispielhaft abarbeiten und versuchen, Stimmen einiger beteiligter Mitglieder einer (hoffentlich) bereits im Aufbau befindlichen Gemeinschaft einzufangen.
„Kunstwerk“, Universität Mozarteum Salzburg, Oktober 2022
Im Erdgeschoss des kleinen Seminarraums der Alpenstraße 75 finden sich langsam durch die Tür tröpfelnd einzelne Personen ein und nehmen an Tischen, teils nebeneinander, teils mit Abstand zueinander Platz. Am Kopf des Raumes, gegenüber von einer hohen Fensterfront steht eine Tafel, auf der wir zu Beginn des Masterseminars, das sich in diesem Semester aufbürdet, das Thema „Kritik (in) der Kunstpädagogik“ auszuloten, Definitionen und Assoziationen zum Begriff „Kritik“ sammeln: Fragen, Hinterfragen, Befragen, Abwägen, Reflektieren, Distanz, negativ, Feedback, Rückmeldung, Kritikfähigkeit, Verbesserung, Emanzipation, Beurteilung, Urteil, Wertung, Herrschaftskritik, Ideologiekritik, Diskriminierungskritik, feministische Kritik, Kunstkritik…
Schreibtisch, Februar 2025
Kritik hat als Konzept im kunstpädagogischen Diskurs eine gewachsene Tradition, die allerdings nicht unbedingt aus dem vordergründigen historischen Selbstverständnis der Disziplin (wenn es denn eine solche überhaupt gibt) erwächst. Ein Blick auf die Wurzeln der Kunstpädagogik im deutschsprachigen Raum legt nahe, dass kunstpädagogisches Tun im schulischen und außerschulischen Kontext beispielsweise mit der Gründung der wegweisenden Kunsterziehungsbewegung ein starkes Augenmerk auf das möglichst breit und offen angelegte sinnliche Wahrnehmen und das freie, fantasievolle Gestalten legt (vgl. Peez 2018; Skladny 2009; Kerbs 1988), wie es allem voran entlang einer kindgerechten Erziehung verhandelt wird, das für die Reformpädagogik spätestens seit Jean-Jacques Rousseaus Émile (Rousseau 2010/1762) leitend ist. Kritik steht hier als Praxis insofern nicht im Zentrum der Kunsterziehungsbestrebungen, weil die Orientierung an einem Ideal des Kindseins Freiheit in der Wahrnehmung und im gestalterischen Ausdruck als zu entfaltende Anlage ansieht, die nicht durch kritische Arbeit erworben werden müsste. Sie entsteht vielmehr in einem affirmativen Eingehen auf intuitive Zugänge zur Welt, sowohl im Bereich der Wahrnehmung als auch im Bereich des Gestaltens. [1] Allerdings zeigt sich eine gewisse ‚kritische‘ Schlagseite vielleicht bereits hier, wenn gerade mit der reformpädagogischen Besinnung auf die Natur des Kindes/ Menschen eine Befragung der dominanten Kultur (vgl. Kerbs 2001) evoziert wird. Ist das aber schon unter „Kritik (in) der Kunstpädagogik“ zu verbuchen? Und, wenn ja, wie nuanciert stellt sich diese Kritik dar und wird sie neben einer basalen Kulturkritik auch als Selbstkritik einer gerade entstehenden Disziplin lesbar?
Diese spannenden Fragen würden eine eingehende Quellenstudie erfordern und müssen an dieser Stelle offen bleiben. Die einzelnen geschichtlichen Versatzstücke, auf die ich knappe Schlaglichter werfe, dienen in dieser Darstellung nicht einer Relektüre der Geschichte der deutschsprachigen Kunstpädagogik im Lichte des Konzepts Kritik, sondern dem Zweck, beispielhaft und punktuell ein Verständnis dafür zu befördern, wie, wo und warum Kritik oder kritische Praxen im Diskurs für das kunstpädagogische Handlungsfeld gefordert werden. Während in der Kunsterziehungsbewegung Kritik, pauschalisiert gesprochen, nicht als kritische Praxis in das kunstpädagogische Handlungsfeld eingeführt wird, sondern vielmehr die geforderten intuitiven Praxen selbst als Kritik am herrschenden Bildungssystem formuliert werden, verhält es sich mit dem nächsten Schlaglicht, dem Erstarken der Bewegung der Visuellen Kommunikation und später der sogenannten Bildorientierung, anders. Kritik am Bildungssystem wird hier mit dem Vermitteln kritischer Praxen gekoppelt. Beleuchten möchte ich dieses Beispiel, weil es nahelegt, dass eine Hinwendung zur Kritik nicht nur mit einer Abwendung vom oben genannten intuitiven Zugang, sondern auch vom lustvollen künstlerischen Gestalten einhergehen kann. Insofern zeugt es von jenen Vorbehalten, die Kritik als eine verkopfte Form der Auseinandersetzung gerade für sinnlich-körperlich orientierte Bereiche wie die Kunstpädagogik problematisieren (so etwa Selle 1988).
Deutlich und explizit wächst ein kritischer Impetus, der die analytisch-rationale Betrachtung des Kritisierten einfordert, spätestens mit der Salonfähigkeit der Kritischen Theorie innerhalb der kunstpädagogischen Diskussionen ab den späten 1960er Jahren. Der Ruf nach einer kritischen Durchleuchtung kulturindustriell verfertigter Artefakte und ihrer vereinnahmenden Wirkungen wird an unterschiedlichen Stellen laut. Mit der Einführung der „Alternative“ (Möller 1982: 21) Visuelle Kommunikation werden etwa Fernsehserien, Superman-Comics, Italo-Western, Jugendzeitschriften oder Werbeanzeigen ideologiekritisch hin auf ihren manipulativen Charakter befragt und als Artefakte einer „Bewußtseinsindustrie“ (Ehmer 1971) befragt. Es scheint dabei besonders wichtig, zu den unmittelbaren, körperlich-sinnlichen, ästhetischen Wirkungen der kritisierten Gegenstände auf Distanz zu gehen, um sie überhaupt analysieren und als manipulierend ausweisen zu können (etwa Baacke 1971, Grünewald/ Sengstmann 1973). Eine solche Strategie nimmt sich kritische Auseinandersetzungen mit Massenmedien zum Vorbild, wie sie etwa von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in ihren Analysen der Kulturindustrie (vgl. Horkheimer/Adorno 1988) oder in der Untersuchung von Fernsehserien (Adorno 1990) durchgeführt werden. Kritiker*innen der Massenmedien ziehen sich gemäß Horkheimer und Adorno aus den unmittelbaren Rezeptionsgeschehen heraus, treten einen oder mehrere Schritte zurück und nehmen ihren Gegenstand mit Abstand sowie mit einer Haltung der Emotionslosigkeit ins Visier, um möglichst scharf, präzise und unaffiziert seine Strukturen und Funktionsweisen zu erörtern. Die Skepsis gegenüber den möglichen Manipulationen massenmedialer Bilder hält sich bis heute (z.B. Billmayer 2018, der vorschlägt, sich den unmittelbaren Wirkungen der Bilder durch das Verfahren des Bilderzählens zu entziehen und damit direkt an die quantitativen Methoden der Bildanalyse (z.B. Trabant 1971) aus dem Zeitalter der Visuellen Kommunikation anknüpft) ebenso wie eine Anlehnung an die Denktradition der Kritischen Theorie (z.B. Schweppenhäuser 2013), die ihr Verständnis von Kritik als eine analytisch-rationale Operation prägt, die das Privileg des sich Herausnehmens aus dem Kontext des kritisierten Gegenstandes für sich beansprucht.
Trotz dieses, zumindest in manchen Nischen beobachtbaren, Fortlebens einer kritisch-distanzierten Praxis der Auseinandersetzung mit potenziell manipulierenden Bildern im kunstpädagogischen Diskurs des deutschsprachigen Raums, zeitigen doch auch jene postkritischen Bewegungen, die zunächst vor allem das literaturwissenschaftliche Denken aufwirbeln (vgl. Felski 2015), ab der Jahrtausendwende einen starken Einfluss auf die Kunstpädagogik. Es tritt die Frage in den Vordergrund, inwiefern Kritik etwas anderes sein könnte als Misstrauen und Abscheu gegenüber dem Kritisierten (Kosofski Sedgwick 2003), also mehr als ein Vollzug von „hate“ (Hodgson/Vlieghe/Zamojski 2017: 18). Vielleicht auch in Reaktion auf die Bedenken der Postkritiker*innen – dass das Kritisieren eine Auseinandersetzung mit der Sache nicht befördert, sondern dagegen eine Abgrenzung von dieser provoziert – suchen Vertreter*innen der Post Internet Art Education nach Strategien, um ihren Gegenstand, nämlich Praxen und Phänomene rund um das Internet, zunächst nicht in einer Abgrenzung, sondern sich ihnen zuwendend (Grünwald/Kolb 2025, Schütze 2020, Tervo 2017, Meyer 2013) für das kunstpädagogische Handlungsfeld zu diskutieren. Während hier der Begriff der Kritik nicht vordergründig ist, sucht demgegenüber die Kritische Kunstpädagogik dezidiert nach neuen, anderen Formen der Kritik, die nach der Kritik an der Kritik angemessen(er) scheinen. Es geht hier um engagierte, durchdringende, emanzipierende, kritische Formen der Auseinandersetzung, die mit einem affektiven und zugewandten Tun vereinbar sind (Mörsch/Nguyen 2025, Puffert 2020, Sternfeld 2014). Mögliche Verbindungen zwischen körperlich-sinnlichen und ästhetischen Erfahrungen sowie künstlerischen Praxen sind dabei zentral. Das eingangs erwähnte Thema der Vergemeinschaftung, in das bell hooks ihre Hoffnung legt, ist zwar an vielen Stellen implizit – wenn etwa vom Umräumen in Seminaren gesprochen wird, die freilich gemeinschaftliche Räume der Auseinandersetzung bilden (Puffert 2020), wenn über das Tanzen auf der Straße gesprochen wird, wo dezidiert zusammen getanzt wird (Sternfeld 2014), oder wo schließlich in der Schule mit Schüler*innen ihre geheimen Lehrpläne erkundet werden, was freilich auch nur in und als Gemeinschaft vollzogen werden kann (Krauss 2019) – kaum aber als explizites Thema zu verorten.
„Kunstwerk“, Universität Mozarteum Salzburg, Oktober 2022
Viele Fragen und unterschiedliche mögliche Perspektiven begegnen uns auch im Seminar. Für einen Teil der Studierenden bleibt das Konzept der Kritik aus meiner Sicht zu erfahrungsbasiert und zeigt sich fest verknüpft mit einem alltagssprachlichen Gebrauch, wie er im ideologiekritischen Anspruch der Visuellen Kommunikation mitschwingt und wie er nicht zuletzt auch in der postkritischen Bewegung breitgetreten wird: Wenn jemand oder etwas kritisiert wird, weisen manche in der Seminargruppe diesen Akt gerade im pädagogischen Kontext als eine negative Geste der Ablehnung zurück, die sich dem Gegenstand nicht offen genug widmet. Kritik ist in einigen Köpfen verbunden mit eben einer Distanz, welche oft als Missgunst ausgelegt wird, die ihr auch die postkritischen Ikonen Kosofski Sedgwick und Felski prominent zum Vorwurf machen.
Ich finde als Lehrende, es ist Zeit für eine künftige Gemeinschaft an der Kunstuniversität, an der ich arbeite. Es ist Zeit, dass wir anders über Kritik nachdenken, anders kritisieren: Wir lesen Texte, die für Öffnungen des Kritisierens hin zu einer humor-und lustvollen (Lüth/ Mörsch 2014), einer affirmativen (Sonderegger 2019, Crary 1998), einer nicht bloß intellektuellen, sondern auch körperlich-sinnlichen Praxis plädieren. Die Theorie sagt, Kritisieren kann ganz nah gehen, es kann affizieren, emotional bewegen und trotzdem für eine Möglichkeit des Abwägens und achtsamen Prüfens sorgen, die schließlich eine klarere Perspektive auf die kritisierte Sache erlaubt. Wir diskutieren, fassen zusammen. Wir legen einen virtuellen Ordner an, in dem wir unsere gemeinsam geschriebenen Zusammenfassungen der Texte, die wir gelesen haben, abspeichern. Und wir überlegen, wie wir unsere Überlegungen in einer sinnvollen Weise vermitteln und zu kritischen Praxen anregen können, die im Sinne eines solch breiteren, inklusiveren Kritikverständnisses sind, wie wir es denkend auszuloten versuchen.
Schreibtisch, Februar 2025
Mit dem Ansatz im Seminar und der Idee, basierend auf unserer Auseinandersetzung mit Kritik einen Workshop im Rahmen der Tagung „Kritik (in) der Kunstpädagogik“ zu entwickeln, sind eine Reihe von Ebenenwechseln verbunden: vom Nachdenken darüber, was Kritik (nicht) ist, zum Reflektieren über das, was Kritik (nicht) tut und wir mit ihr (nicht) tun (können); vom Erörtern der Grenzen und Reichweiten von Kritik zum Diskutieren des konkreten Wirkungsraumes im kunstpädagogischen Feld; vom Unterscheiden zwischen dem kunstpädagogischen Diskursfeld und dem kunstpädagogischen Praxisfeld zum Entwickeln von kritischen Interaktionsmöglichkeiten in den jeweiligen Feldern.
In der deutschsprachigen kunstpädagogischen Diskussion, wie ich sie entlang von wenigen Fällen dargestellt habe, taucht Kritik, mal implizit und mal explizit, immer wieder und ebenso auf unterschiedlichen Ebenen auf: Hier als Kritik am Bildungssystem und damit gewissermaßen auf einer Metaebene situiert; dort als Kritik am massenmedialen Apparat der Bewusstseinsindustrie und mit direkten Folgen, die für das kunstpädagogische Handlungsfeld eingemahnt werden; und an wieder anderer Stelle als Herrschaftskritik mit erweiterten, nicht nur intellektuellen Mitteln, zu denen auch künstlerische Ausdrucksformen zählen. In vielen Fällen wird eine Metaebene mit anderen Ebenen, praxisorientierten wie auch theoriebildenden, vielschichtig verknüpft. Die besprochenen Überlegungen bewegen sich damit im Spannungsfeld dessen, was an Mehrschneidigkeit im Titel der Tagung „Kritik (in) der Kunstpädagogik“ angedeutet ist: Sie breiten sich auf zwischen einer Kritik der Kunstpädagogik (im Sinne eines Genitivus subjectivus, also jener kritischen Zugänge und Verfahren, die die Kunstpädagogik als eine spezifische Disziplin bemüht), einer Kritik der Kunstpädagogik (im Sinne eines Genitivus objectivus, also einer Kritik an der Kunstpädagogik, verstanden als Disziplin, aber auch als praktisches Feld) und einer Kritik in der Kunstpädagogik, also kritischen Konzepten und Praktiken, die sich in kunstpädagogischen Diskursen und Feldern aufspüren lassen.
So vielschichtig und mitunter widersprüchlich das in diesen Perspektiven transportierte Verständnis darüber ist, wo das Kritisieren beginnt und wo es aufhört, was es mit seinen Gegenständen macht und wie es sich zu diesen positioniert sowie worin es denn schließlich resultiert (in Urteilen, in Ablehnungen, in Zuwendungen, in hate oder, womöglich, in love), so einig sind sich doch die meisten Positionen, dass es wichtig ist, dass die Player in den diversen kunstpädagogischen Feldern – sowohl die Lehrenden wie auch die Lernenden, die Theoretisierenden wie auch die Praktizierenden – kritisch sein sollten. Dass Kritikfähigkeit, das Vermögen also, kritisch zu sein und kritisch zu handeln, erstrebenswert ist, auch wenn eine kritische Haltung nicht immer und überall dezidiert gefragt ist, wird selten in Frage gestellt. Wie aber auf eine solche Kritikfähigkeit nicht nur gebaut werden kann, sondern wie sie als ein Vermögen erworben werden kann, bleibt an manchen Stellen unklar. Noch unklarer ist, wie der Erwerb dieses Vermögens nicht von „oben“, nämlich von denen, die bereits kritikfähig sind oder sich als kritikfähig begreifen, gesteuert werden könnte, sondern wie sich eine, mit bell hooks gesprochen, gemeinschaftliche „Arbeit“ an unser aller Kritikfähigkeit einstellen könnte.
Freilich bin ich selbst wiederholt darüber gestolpert zu steuern; als Lehrveranstaltungsleiterin und ebenso als Tagungsveranstalterin ist es unmöglich, die Entwicklung des Seminars und das Entstehen der Tagung voll und ganz der Gemeinschaft zu überantworten. Manchmal habe ich im Seminar selbst bemerkt, dass ich von „oben“ herab unterrichte. Manchmal habe ich es aber auch erst im Nachhinein realisiert, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich mit so großem Abstand darüber nachdenke, was vor zweieinhalb Jahren passiert ist, oder wenn mich meine Kollegin Birke Sturm beim Lesen dieses Textes darauf aufmerksam macht, dass ich mich aus der Gemeinschaft herauslöse und einen zu großen Unterschied zwischen mir und den Studierenden einführe, wenn ich über unser jeweiliges Verständnis von Kritik schreibe und finde, dass viele zu sehr an ihren bisherigen Auffassungen festhalten. Nicht nur die gemeinschaftliche Arbeit bleibt also weiterhin zu tun; auch die Arbeit, so gemeinschaftlich wie möglich zu agieren, ist eine beständige, die für das kunstpädagogische Handlungsfeld Schule ebenso Relevanz besitzt wie für die Universität.
Gemeinschaften sind an vielen Bildungsorten bereits vorhanden, so etwa in der Schule; mehr noch als Universitäten sind Schulen Gemeinschaftsorte, die teilweise über Jahre relativ stabil bestehende Konstellationen von Individuen in Form von Klassengemeinschaften schaffen. An der Universität verhält es sich durch die größtenteils freie Gestaltung des Studienverlaufs anders; an Kunstuniversitäten wie der, an der ich arbeite, ist es eine überschaubare Anzahl von Studierenden, die sich innerhalb derselben Studienrichtungen in wechselnden Lehrveranstaltungsgemeinschaften begegnen. Dadurch sehen sich vor allem diejenigen, die in denselben Jahrgängen ihr Studium aufgenommen haben, regelmäßig und sind entsprechend bereits zu einem gewissen Grad vergemeinschaftet. Die Bereitschaft, bewusst gemeinschaftlich an Projekten im Unterricht zu arbeiten, ist in meiner bisherigen Erfahrung als Universitätslehrerin dabei allerdings sehr unterschiedlich. Manchen Studierenden fällt es leichter als anderen; manche sind von vornherein skeptisch und bevorzugen die Arbeit für sich. Und auch mir als Lehrveranstaltungsleiterin gelingt freilich die gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit manchen Personen und Konstellationen besser als mit anderen.
In der Seminargruppe aus dem Wintersemester 2022/23 war das Interesse am gemeinschaftlichen Prozess bei den meisten Studierenden vorhanden. Dadurch waren die Voraussetzungen für das Nachdenken darüber, wie unsere Arbeitsweise im Seminar auf den Workshop im Rahmen der Tagung übertragen werden könnte, sehr gut. In der akzidentiellen Konstellation, in der wir uns im Oktober 2022 zusammenfanden, machten wir uns an die Arbeit, einen Workshop zu entwickeln, in dem die Teilnehmenden dazu angeregt werden sollten, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie kunstpädagogisch angemessene Formen des Kritisierens nicht nur aussehen, sondern auch vermittelt werden könnten.
„Kunstwerk“, Universität Mozarteum Salzburg, November 2022
Antworten darauf, wie angemessene Formen des Kritisierens grundsätzlich vermittelt werden könnten, gibt es in Texten und kunstpädagogischen Entwürfen unterschiedlichste: Manche geben konkrete Vorstellungen davon, was in ausgewählten Situationen im Feld zu tun wäre, und bleiben eklektizistisch; manche sind allgemein gehalten und bleiben mit Blick auf zu vollziehende Praxen sehr vage. Im Wirrwarr einer Vielfalt an geäußerten und hohen Ansprüchen, haben wir es uns im Seminar zur Aufgabe gemacht, Theorie und Praxis so miteinander zu verschränken, dass sich im konkreten Tun unterschiedliche, von uns als wichtig erachtete Aspekte des theoretisch Durchdrungenen transportieren, und das in einem gemeinschaftlichen Setting. Wir haben also neben Antworten auf die Frage, wie kunstpädagogisch angemessenes Kritisieren angestoßen werden könnte, auch nach Perspektiven gesucht, wie sich ein solches Ausüben von Kritik in Gemeinschaft vollziehen kann.
Weil in unserer „künftigen Gemeinschaft“ der Seminargruppe die Ansichten darüber, was besonders wichtig ist, breit gestreut blieben, haben wir uns für einen Workshop als Stationenbetrieb entschieden: Wir haben eine Reihe von Stationen entwickelt, die die Teilnehmenden der Tagung „Kritik (in) der Kunstpädagogik“ innerhalb einer Stunde durchlaufen konnten. Jede Station musste als Interaktionspunkt von mindestens zwei Personen miteinander „bespielt“ werden und drängte somit auf eine Minimalform der Vergemeinschaftung. Uns war in der Konzeption wichtig, dass sich die gemeinschaftlichen Konstellationen dynamisch entwickelten, weswegen wir den Wechsel zwischen den Stationen mit einem kurzen, musikalisch untermalten Herumspazieren im Raum verbanden, wobei sich die Spazierenden mit dem Enden der Musik an den jeweiligen Standorten, wo sie sich gerade befanden, und mit den Personen, mit denen sie dort zusammentrafen, niederlassen sollten. Im Veranstaltungsraum war es laut und umtriebig. Es wurde viel und angeregt gesprochen, dort und da getänzelt, hie und da gewitzelt.
Ich möchte beispielhaft drei der aufgebauten und bespielten Stationen herausgreifen, um den Zugang zur Kritik in ihnen und den Versuch der Vermittlung derselben zu skizzieren:
Eine Station in der Mitte des Raumes lud dazu ein, einen „Kritikroboter“ zu entwerfen. Dabei war partnerschaftliches Designen und damit gemeinschaftliches Engagement gefragt, indem dieser Roboter zumindest von zwei Ingenieur*innen gestaltet werden musste. Die Spieler*innen an dieser Station mussten sich entsprechend in die Rolle eines Mitglieds im „Design your own critique robot“-Team versetzen. Als solches war es ihre Aufgabe eine Maschine zu entwerfen, die kritische Operationen vollzieht. Die Aufgabenstellung an der Station verlangte danach, neben einem visuellen Entwurf, der gezeichnet und/oder unter Verwendung von vorliegenden Bildelementen collagiert werden konnte, eine Beschreibung der Funktionen des Roboters vorzunehmen. Welche kritischen Operationen vollzieht der Roboter und wie tut er das? Welche Werkzeuge besitzt der Roboter, um diese Operationen durchzuführen, und inwiefern sind diese als Werkzeuge der Kritik zu bezeichnen? Wie be- und verarbeiten die Werkzeuge ihren Gegenstand? Mit welchen Gegenständen kann der Roboter arbeiten? Welche Produkte werden schließlich vom Kritikroboter hervorgebracht?

Abb. 1: 3 kritische Roboter, Dokumentation des Workshops am 22.11.2022
An einem anderen Ort, nicht weit vom Kritikroboter entfernt, waren die Mitspielenden gebeten, kleine Geschichten über die „Zukunft der Kritik“ zu schreiben. An einem Tisch waren zwei Büchlein im A5 Format platziert. Die Teilnehmenden, die sich an dieser Station einfanden, wurden eingeladen, eine der beiden bereits begonnenen Geschichte über die Zukunft der Kritik in partnerschaftlicher Arbeit fortzuschreiben. Während in die „Zukunft der Kritik 1“ eine dystopische Geschichte den Anstoß zum weiteren Erzählen gab, war es in die „Zukunft der Kritik 2“ ein eutopisches Szenario, das den Auftakt markierte. An dieser Station wurde nicht nur geschrieben, es wurde auch gezeichnet, skizziert, erklärt, fabuliert und viel geträumt. Je mehr der Workshop voranschritt und je öfter die Station bereits bespielt worden war, desto mehr erzählerisches Material lag bereits vor und desto größer wurde damit die Gemeinschaft, die gemeinsam und sukzessiv die erzählten Geschichten hervorbrachte. Das Schreiben betonte anders als das Designen im Falle des Kritikroboters eine narrative bzw. reflektierende Vorgehensweise und adressierte damit eine andere Ebene der Auseinandersetzung mit Kritik und kritischer Praxis: An manchen Stellen der Geschichten wurde entsprechend auch über Kritik geschrieben, an anderen Stellen wurde von Kritik erzählt und an wieder anderen Stellen wurde das Geschriebene mit den Mitteln des Kommentierens kritisiert. Dadurch, dass die Spieler*innen zu zweit zum Schreiben aufgefordert waren, war es nie ein stilles, kontemplatives Aufzeichnen, sondern es war stets ein lautes, diskursives sich Auseinandersetzen mit der*m Mitspielenden und der vorliegenden, bereits erstarrten Erzählung.

Abb. 2: 2 kritische Geschichten, Dokumentation des Workshops am 22.11.2022
In einer Ecke des Raumes und damit etwas geschützter als in der Mitte des Geschehens befand sich eine Station, die neben den zwei beschriebenen Zugängen des Designens/Entwerfens/ Skizzierens und des Schreibens/Erzählens eine weitere Ebene zum Kritisieren erfahrbar und reflektierbar machen wollte. Es wurde hier nach den körperlich-performativen Dimensionen des Kritisierens gefragt. An der Station wurden die Spielenden dazu aufgefordert, vor und für eine auf einem Stativ platzierte Fotokamera kritische Gesten zu verkörpern. Weniger auf gemeinschaftliches Engagement im Sinne einer synchronen Zusammenarbeit besonnen als andere Stationen, stand hier der asynchrone Moment der Vergemeinschaftung im Vordergrund. Die Fotokamera war als Platzhalter für andere gedacht und die Aufgabe war, sich dieser kommunizierend zuzuwenden, also durch die Kamera Anderen über körperlichen Ausdruck die eigene kritische Haltung zu vermitteln. Die Idee hinter dieser Station war darauf hinzuweisen und das Nachdenken darüber anzuregen, dass oft nicht nur durch Worte kritisiert wird, sondern vor allem auch durch, nicht selten subtile, Gesten.
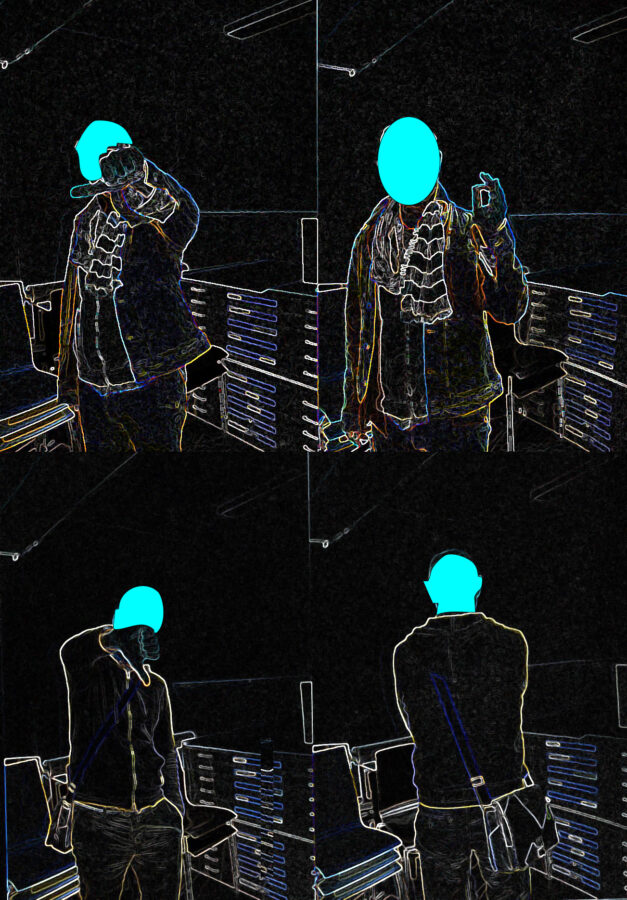
Abb. 3: 4 kritische Gesten, Dokumentation des Workshops am 22.11.2022
Der einstündige Workshop bot vielen Teilnehmenden bunte und unterschiedliche Gelegenheiten auszuloten, wo sie Ansätze eines Kritisierens finden können, das weniger auf Distanzierung, sondern vielmehr auf Zuwendung und vor allem auf kommunikatives, partnerschaftliches Engagement setzt. Der gesamte Stationenbetrieb war ein Versuch, in der Universität gemeinsam kritisch zu agieren und dabei Spaß zu haben, zu lachen, sich voneinander zu erzählen, Perspektiven zu teilen, zu diskutieren und neue Sichtweisen zu entdecken.
Vom Raum der Begegnung zu diversen vernetzten Schreibtischen, November 2022 bis März 2025
Das Masterseminar und die Tagung „Kritik (in) der Kunstpädagogik“ waren zwei sich überlappende Versuche einer gemeinschaftlichen Arbeit an einem für kunstpädagogische Felder angemessenen Verständnis von Kritik, die geknüpft war an die Hinterfragung der Vorherrschaft eines Begriffs von Kritik als ausschließlich rational-analytischer Operation. Ob eine Gemeinschaft entstanden sein wird und wer sich als Teil dieser Gemeinschaft begriffen haben wird, kann nur die Zukunft zeigen. Mögliche Beteiligte an einer gemeinschaftlichen Arbeit sind und waren aber neben den Masterstudierenden die Mitspielenden, die Beitragenden an der Tagung, die Teilnehmenden, die Diskutierenden und schließlich nun die Autor*innen dieser Textsammlung. Sie setzen sich zusammen aus Beitragenden der Tagung, jenen, die selbst Vorträge gehalten haben,[2] und jenen, die zwar keine Vorträge gehalten haben, aber die ebenso als Diskutierende, Mitdenke und den Workshop Gestaltende beigetragen haben. Mit ihnen habe ich spätestens seit der Tagung im November 2022, teilweise aber bereits davor, ein anhaltendes kritisches Gespräch gepflegt durch, über und entlang der Beiträge, die sich in dieser Sammlung nun begegnen. Ich bin mir sicher, sie haben sich ihrerseits mit anderen vor dem Hintergrund ihrer Texte auseinandergesetzt. Die Zuwendung zu den Ausführungen der Autor*innen, die entstehenden dialogischen Schleifen, die aufkommenden Fragen, die darauf erbrachten Antworten und die neuen Fragen, die in diesen Ping-Pong-Spielen entstanden sind: All das war, ist und wird hoffentlich auch Teil einer kritischen Arbeit in einer Gemeinschaft bleiben.
Katja Hoffmann eröffnet diese Textsammlung. Sie widmet sich der Nähe und den Übergängen zwischen den beiden Konzepten Kritik und Reflexion. Dabei interessiert sie sich besonders für jene normativen Aspekte, die sowohl Kritik als auch Reflexion als Praxen im wissenschaftlichen ebenso wie im kunstpädagogischen Feld unterfüttern. Am Beispiel des Umgangs kunstpädagogischer Ansätze im deutschsprachigen Raum mit der kolonial geprägten europäischen Kunstgeschichte zeigt sie, wie eine Reflexion und Kritik, die sich der eigenen normativen Rahmung bewusst ist, anders mit außereuropäischer Kunst umgehen kann. Epistemologische Perspektiven, die nach den Weisen des Verstehens und Erkennens von in diesen Artefakten gebündelten Wissen fragen, verschränken sich mit ethischen Fragen danach, welcher Zugang zu diesen potenziellen Wissensdimensionen im Sinne einer dekolonialen Haltung angemessen ist. Für sie ist es eine Kunstpädagogik der Übergänge und der Multiperspektivität, die sie am Horizont ihrer Überlegungen anvisiert und die eine kritische wie auch reflexive Arbeit erfordert, die sich ihren jeweiligen normativen Fundierungen widmet, sich mit diesen auseinandersetzt, ohne aber dem Glauben zu verfallen, dass sie vermieden oder ausgeklammert werden könnten.
Kritik steht mit Reflexion in einem engen Zusammenhang, so viel zeigt sich auch im Beitrag von Stefanie Johns. Sie arbeitet an einem Verständnis von Kritik als Hinterfragen, das sich in einem Zwischen ereignet. Kritisieren braucht einen Zwischenraum, in dem getrennt, unterschieden, Abstand genommen und neu konstelliert wird. Jene Dis- und Assoziationen, die kritische Praktiken ermöglichen, können als Passagen der Ermächtigung begriffen werden. Die Betonung des Zwischen ermöglicht es der Autorin, Reflexion und Kritik in ein Verhältnis zueinander zu setzen. Mit den beiden ersten Beiträgen in dieser Textsammlung zeigt sich damit bereits deutlich, dass die beiden Konzepte Reflexion und Kritik für die Kunstpädagogik in ihrem Verhältnis zueinander von Interesse sind. Reflexion kann als ein Modus kritischer Betrachtung verstanden werden. Aber nicht nur das, Reflexion kann auch einen Weg zum Kritisieren als einer situierten Kritik bahnen: Wenn Reflexion nämlich ein Bewusstmachen, Befragen und damit einhergehendes Relativieren der eigenen Situation bedeutet, dann wird deutlich, inwiefern sie selbst bereits kritische Momente in sich trägt und gleichsam Ausgangspunkt einer kritischen Neuausrichtung sein muss. Vieles von dem, was es braucht, um zu einer Reflexion mit kritischem Impetus überhaupt fähig zu sein, hat mit Erfahrungen zu tun, die aus dem Raum des bereits Gewussten ausscheren. Stefanie Johns zeigt, wie kunstpädagogische Zugänge durch das Schaffen von Umwegen Erfahrungsräume aufreißen, die ein fruchtbares Feld für Reflexion und Kritik bieten, indem sie Alternativen zu bestehenden Normierungen schaffen.
Anders als Stefanie Johns interessiert sich Cornelia Zobl weniger für die spezifisch kunstpädagogisch konstruierten Erfahrungsräume. Sie fokussiert dagegen und bewusst die Welt der Dinge, also die materialisierte Phänomenwelt des Alltags. Damit stehen in ihrem Beitrag gerade jene Normierungen im Zentrum, von denen in den Beiträgen davor Abstand genommen wurde. Für die Autorin bildet daher auch weniger der Erfahrungsraum den Hauptfokus der Untersuchung, sondern sie fokussiert Haltungen, Wissen und ‚Werkzeuge‘, die es braucht, um Dinge des Alltags kritisieren zu können oder in ihrer kritischen Potenzialität allererst begreifen zu können. Damit legt sie das Augenmerk auf die Kritik an dem, was uns am nächsten liegt: Wie kann ein Abstand von jenen einnehmenden Bewegungen des Gebrauchens und Benutzens, des Konsumierens und Genießens, des Glaubens und des Annehmens gelingen, damit Kritik und in Folge Bildung möglich wird? Das ist die zentrale Fragestellung, die Cornelia Zobl verfolgt, und die sie mit der Entwicklung von zwei Perspektiven beantwortet: eine, die die Verschränkung von Dingen und den etablierten Erzählungen über Dinge betont und einfordert, dass diese Verschränkung in der Kritik von Dingen ins Zentrum gerückt werden muss und eine zweite, die fordert, dass die Praxis im Umgang mit Dingen selbst als Ausgangspunkt für kritisches Handeln begriffen werden muss. Schon kleine Verschiebungen können genügen, um ein Tun anzuregen, das sich kritisch zum alltäglichen Umgang mit den Dingen verhält.
Die Autonomie und die Funktionslosigkeit, die den Dingen zu fehlen scheint und sie von Manifestation der Kunst unterscheidet, markiert einen wichtigen Einsatzpunkt des Beitrags von Rahel Puffert. Sie wendet sich dem Betonen der Autonomie von Kunst und künstlerischer Praxis zu, wie es in der Kritik an der documenta fifteen neu erstarkt ist. Insbesondere das Kollektiv ruangrupa wurde in internationalen Debatten hin auf seine kuratorische Verantwortung befragt, da es Taring Padis „People’s Justice“ trotz antisemitischer Darstellungen einen prominenten Ausstellungsplatz eingeräumt hatte. In der Diskursanalyse, die Rahel Puffert in ihrem Beitrag durchführt, wird deutlich, inwiefern die Problematisierung kollektiver Praxis Hand in Hand geht mit dem Absprechen von künstlerischer Wertigkeit einerseits und der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung andererseits. Die Frage „Wer steht ein, wenn es keine*n eineindeutig zu identifzierende*n Macher*in gibt?“ wird zum unüberbrückbaren Problem für konservative Kräfte innerhalb der Kunst- und Kulturdiskurse, die klare Autor*innenschaften und Bekenntnisse fordern. Diesen Forderungen von Personen, die letztlich das, was Kunst ausmacht, in die breitere Öffentlichkeit hinein vermitteln, geht die Autorin in ihrem Beitrag als Inszenierungen von Kritik nach, die mit tiefgehender kritischer Auseinandersetzung allerdings wenig zu tun haben. Kritische Arbeit über Kunst, also kunstpädagogische und kunstvermittlerische Arbeit, ist, ganz im Sinne dieser Textsammlung, Arbeit mit und in Gemeinschaft, im Kollektiv, die es verunmöglicht, mit unumstößlicher Sicherheit zu sagen, welches Individuum für welche Entscheidung zur Verantwortung gezogen werden kann. Diese Unmöglichkeit ist allerdings keineswegs als Plädoyer für Verantwortungslosigkeit zu begreifen, sondern vielmehr eine Herausforderung der kunstpädagogischen und -vermittlerischen Auseinandersetzung selbst, wie die Autorin mit ihrem Beitrag betont.
Kunstpädagogisches Handeln und speziell institutionalisierte Formen der Kunstvermittlung vollziehen sich allerdings in der Praxis im Rahmen eines gewachsenen Regelwerks. Über dieses Regelwerk als geschichtlich durchdrungenes und fundiertes System denkt Volkmar Mühleis in seinem Beitrag nach. Er reflektiert über die Rolle von Konzepten, Begriffen und (impliziten) Handlungsnormen in kunstvermittlerischen Räumen am Beispiel von deutschen, französischen und flämischen Institutionen. Durch das Einflechten seiner eigenen Erfahrungen als Kunstvermittler in unterschiedlich gewachsenen institutionellen Settings zeigt der Autor deutlich, wie sehr sich Tradition und Prägung nicht nur in handlungsleitende Praxen und Wege zur Vermittlung einschreiben, sondern auch in das Grundverständnis dessen, was überhaupt als Ziel von Vermittlungsprozessen begriffen werden kann. Das Verständnis dessen, wo und wie sich Kunstvermittlung (kritisch) vollziehen kann, steht in enger Verbindung mit situierten Begriffsgeschichten und Ausformungen von pädagogischen Vorstellungen, die letztlich mit Sprache eng zusammenhängen und entsprechend schwer übersetzbar bleiben. Kritische Vermittlung muss sich auf diese Situierungen einlassen, um letztlich nicht ins Leere zu greifen.
In Institutionen, in denen Kunst vermittelt wird, gilt zwar stets ein spezifisches Regularium. Dieses kann aber im Lichte von konkreten Ereignissen und Debatten herausgefordert werden. Barbara Mahlknecht wendet sich solchen Ereignissen und Debatten zu, die einen Wechsel in der Kunstkritik und somit gleichermaßen auch in der Kunstvermittlung bewirkt haben. Der turn, den sie beschreibt, ist eng gebunden an das Erstarken jener zeitgenössischen Kunstpraktiken, die auf die Notwendigkeit verweisen, Sorge (care) als Thema in der Auseinandersetzung nicht weiter auszuklammern, sondern ganz bewusst ins Zentrum zu rücken. Die vergangenen Jahrzehnte machen deutlich, wie die Autorin zeigt, dass mit einer Kritikalität liebäugelnde Hinterfragungen des (Kunst-)Systems nicht mehr ausreichen. Es braucht neben einem Aufzeigen dessen, was ‚falsch‘ läuft, ethisch angemessene Haltungen und Umgangsweisen. Wie ein Hinterfragen, ein Zerlegen und Dissoziieren mit einem Zuwenden, sich Kümmern und dem sich Sorgen verknüpft werden kann, bleibt nicht nur für wissenschaftliche Zugangsweisen eine Aufgabe, die oben bereits mit Blick auf die Kritik an den postkritischen Bewegungen angedeutet wurde, sondern – vielleicht noch deutlicher – im Feld der Kunst und der Kunstvermittlung. Komplexe gesellschaftliche Bewegungen verlangen nach einer Behandlung von komplexen Fragestellungen. Was bedeutet dieses Verhandeln und Kreisen um Sorge nun konkret für die Kunstvermittlung? Barbara Mahlknecht beantwortet diese Frage, indem sie nach einem Übergang von der kritischen Kunstvermittlung zu einer Kunstvermittlung verlangt, die sich zwischen Kritik und Sorge aufspannt. Kritisieren wäre in einer solchen Praxis nicht auf der Distanz und aus einer enthobenen Perspektive vollzogen, sondern situiert, zugewandt und fürsorglich. Eva-Maria Schitter geht in ihrem Beitrag einer ähnlichen Frage nach, wenn sie sich für jene Formen der Kritik interessiert, die in ästhetischen Erfahrungsräumen vollzogen werden. Für sie ist es nicht die Sorge, die sie terminologisch anvisiert, sondern die Nähe oder das Nahe-Werden. Genauer fokussiert sie dabei den Aspekt der Vermittlung in ästhetischen Erfahrungsräumen und untersucht diesen entlang von zwei Beispielen aus dem Feld der Repräsentationskritik: Annette Krauss und Nora Sternfeld, denen sie sich zuwendet, beziehen sich dabei beide auf das Konzept des Unlearning, um welches damit letztlich auch dieser Text kreist. Während Annette Krauss mit ihrem Projekt Hidden Curriculum den Möglichkeiten und Grenzen der Kritik am bestehenden Wissenssystem Schule nachgeht, interessiert sich Nora Sternfeld für außerschulische, nicht zuletzt museale Vermittlungsorte. Wo Krauss die Kunst als Interventionsstrategie in die Schule einschleust, um gemeinsam mit Schüler*innen hegemoniale Strukturen zu untersuchen, denkt Sternfeld darüber nach, wie es Kunstvermittler*innen möglich werden kann, in unterschiedlichen, nicht selten institutionalisierten Rahmen kritische Arbeit zu verrichten, indem sie die Interventionsstrategien der Kunst sichtbar und begreifbar machen. Partizipation ist dabei für beide Ansätze ein wichtiges Moment, da es gilt, das Nachdenken über andere, kritische Vermittlungsansätze bewusst und nachhaltig einzufordern. Ebenso wie die Notwendigkeit der Einführung partizipativer Formate betonen beide Denkerinnen die Wichtigkeit, Kritik als eine zu erwerbende Praxis zu begreifen; das Verlernen, von Krauss auch als Ent-Üben gefasst, gilt beiden als zentraler Weg zum Kritisch-Werden. Bei aller Resonanz zwischen den beiden Positionen zeigt sich hier aber einer der wesentlichen Unterschiede, auf den die Autorin hinweist: Während das Ent-Üben bei Krauss einen Prozess beschreibt, in den sich die Künstlerin gemeinsam mit den Schüler*innen begibt und der sich damit in der Vermittlungssituation selbst vollzieht, ist das Verlernen bei Sternfeld als dem Vermittlungsgeschehen selbst vorgelagerte Arbeit verstanden: Bevor die Vermittler*innen ins Feld gehen, sind sie aufgerufen selbst zu Lernenden zu werden, die verlernen müssen. Aus der Gegenüberstellung der beiden Zugänge vor dem Hintergrund eines auf Repräsentationskritik zielenden Verständnises von Verlernen schlägt Eva-Maria Schitter schließlich vor, Kritisieren als einen Prozess zu fassen, der ein Nahekommen und Nahe-Sein mit dem Kritisierten erfordert: Kritik wird so weniger als Distanznahme begriffen, sondern ein sich dem Kritisierten Widmen. Insofern ist das Kritisch-Werden eng geknüpft an den Erwerb von nicht zuletzt ästhetischen Fertigkeiten.
Birke Sturm schließt die Textsammlung mit einem historischen Rückblick in die 1970er Jahre. In dieser Zeit verzeichnete die deutschsprachige Kunstpädagogik eine Wende, die insofern kritisch genannt werden könnte, weil sie dezidiert einfordert, bestimmte Gegebenheiten und als solche identifizierte Ideologien der Zeit zu hinterfragen. Für die Autorin sind es Aspekte von Gesellschaftskritik, die sich in den diskutierten Positionen je unterschiedlich zeigen und die nicht nur ein Zeichen der Zeit darstellen, sondern weiterhin Anlass bieten, um über das Verhältnis zwischen Hinterfragen und Entwerfen wünschenswerter Perspektiven in der kritischen Praxis nachzudenken. Für die in den Fokus gerückten historischen Fälle betont Birke Sturm die Veränderungen des Selbstverständnisses und des Handelns von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Lehrpersonen im kunstpädagogischen Diskurs. Es lässt sich ein zunehmender Fokus auf jugendliche Lebenswelten und populärkulturelle Artefakte verzeichnen, der – zumindest potenziell – auf einen inklusiveren Kunstunterricht abzielt. Es wird hier somit eine Dimension von Kritik angesprochen, die sich als Praxis in der Kunstpädagogik etabliert, um den Wert des Kunstunterrichts – einmal mehr in seiner Geschichte – für die Gesellschaft zu zeigen.
Anmerkungen
[1] Der Fokus auf das Wecken der rezeptiven Kräfte zeigt sich sehr deutlich bei Konrad Lange, wenn er von der „Erziehung des Kindes zur ästhetischen Genußfähigkeit “ (Lange 1966: 21) spricht und diese so beschreibt: „Und unsere Absicht geht […] dahin, den bei allen Menschen im Keime vorhandenen Kunstsinn zu wecken und auszubilden [.]“ (Ebd.: 22). Karl Götze betont dagegen die Wichtigkeit des Zeichnens als eine produktiv-hervorbringende Kraft, die ebenso bereits im Kinde angelegt sei und die der Mensch „in der Jugend selbsttätig vollziehe“ (Götze 1966: 23).
[2] Annette Krauss, die an der Tagung als Vortragende mitgewirkt hat und in diesem Rahmen mit uns viel und intensiv über Kritik (in) Kunstpädagogik diskutiert hat, konnte leider keinen schriftlichen Beitrag Neben ihr war auch Nanna Lüth Vortragende, die ebenso keinen Beitrag beisteuern konnte. Ihnen beiden sei aber an dieser Stelle nochmals ganz ausdrücklich gedankt, dass sie mit ihren wertvollen Perspektiven in Vieles, was hier in dieser Textsammlung zu finden ist, hineingewirkt haben und damit meinem Verständnis nach definitiv Teil dieser Gemeinschaft sind.
Literatur
Adorno, Theodor W. (1990): Prolog zum Fernsehen. In: Hans-Bredow-Institut (Hrsg.): Rundfunk und Fernsehen 1948–1989. Ausgewählte Beiträge der Medien-und Kommunikationswissenschaft aus 40 Jahrgängen der Zeitschrift »Rundfunk und Fernsehen«. Baden-Baden u.a.: Nomos.
Baacke, Dieter (1971): Der traurige Schein des Glücks. Zum Typus kommerzieller Jugendzeitschriften. In: Ehmer, Hermann K. (Hrsg.): Visuelle Kommunikation: Beiträge zur Kritik der Bewußtseinsindustrie. Köln: DuMont Schauberg, S. 213-250.
Bast, Gerald (2019): Wir wenden Zukunft an! In: Benda-Lautner, Renate u.a.: Kunstuniversitäten in Österreich. Was Sie schon immer über Kunstuniversitäten wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, S. 22-23.
Billmayer, Franz (2018): Bilder zählen. In: Loffredo, Anna Maria (Hrsg.): Causa didactica. Professionalisierung in der Kunst/Pädagogik als Streitfall. München: kopaed.
Crary, Richard (1998): Critical Art Pedagogy. Foundations for Postmodern Art Education. New York: Routledge.
Ehmer, Hermann K. (1971) (Hrsg.): Visuelle Kommunikation: Beiträge zur Kritik der Bewußtseinsindustrie. Köln: DuMont Schauberg.
Felski, Rita (2015): The Limits of Critique. Berlin: De Gruyter.
Freire, Paolo (1998): Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Grünewald, Dietrich/Sengstmann, Ingelore (1973): Visuelle Kommunikation in der Schule. Zur Didaktik eines neuen Unterrichtsfaches. Düsseldorf: Pro Schule.
Grünwald, Jan/Kolb, Gila (2025): _ we love digitality. does digitality love us back? Ein Gespräch. In: Bernhofer, Andreas et al. (Hrsg.): Cringe or Worthy? Wien: LIT Verlag.
Lüth, Nanna/Mörsch, Carmen (2014): Queering (Next) Art Education. Kunstpädagogik zur Verschiebung dominanter Zugehörigkeitsordnungen. In: Meyer, Torsten/Kolb, Gila (Hrsg.): What’s Next. Art Education. Ein Reader. München: Kopaed.
Hodgson, Naomi/Vlieghe, Joris/Zamojski, Piotr (Hrsg.) (2017): Manifesto for a Post-Critical Pedagogy. punctum books.
hooks, bell (2024): Gemeinschaft leben lernen. Bildung als Praxis der Hoffnung. Münster: Unrast. Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1988): Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt am Main: Fischer.
Kerbs, Diethardt (1988): Kunsterziehungsbewegung. In: Kerbs, Diethardt/Reulecke, Jürgen (Hrsg.): Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880-1933. Wuppertal: Peter Hammer Verlag, S. 369-378.
Kerbs, Diethardt (2001): Kunsterziehungsbewegung und Kulturreform. In: Maase, Kaspar/Kaschuba, Wolfgang (Hrsg.): Schund und Schönheit. Populäre Kultur um 1900. Köln u.a.: Böhlau, S. 378-397.
Kosofsky Sedgwick, Eve (2003): Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Duke University Press.
Krauss, Annette (2019): Unlearning institutional habits: an arts-based perspective on organizational unlearning. In: Klammer, Adrian/ Grisold, Thomas/Nguyen, Nhien (Hrsg.): The Learning Organization, 26 (5), Bingley: Emerald Publishing Limited, S. 485-499. https://doi.org/10.1108/TLO-10-2018-0172
Meyer, Torsten (2013): Next Art Education. Kunstpädagogische Positionen 29. Hamburg: Repro Lüdke. Möller, Heino R. (1982): Gegen den Kunstunterricht. Versuche zur Neuorientierung. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag.
Mörsch, Carmen/Nguyen, NhuY Linda (2025): Handarbeit als kolonialitätskritische erinnerungspolitische Intervention. In: Laner, Iris/Oberprantacher, Andreas (Hrsg.): Politische Bildung als ästhetische Bildung – Ästhetische Bildung als politische Bildung?! Weinheim: Beltz Juventa.
Peez, Georg (2018): Einführung in die Kunstpädagogik. Stuttgart: Kohlhammer.
Puffert, Rahel (2020): Umräumen statt aufräumen. Kunstpädagogische Positionen. Band 52. Hamburg: Hamburg Univ. Press.
Rousseau, Jean-Jacques (2010 [1762]): Émile oder über die Erziehung. München: Anaconda.
Schütze, Konstanze (2020): Bildlichkeit nach dem Internet. Aktualisierungen für eine Kunstvermittlung am Bild. München: kopaed.
Schweppenhäuser, Gerhard (2013): Bildstörung und Reflexion: Studien zur kritischen Theorie der visuellen Kultur. Würzburg: Königshausen und Neumann.
Selle, Gert (1988): Gebrauch der Sinne. Eine kunstpädagogische Praxis. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Skladny, Helene (2009): Ästhetische Bildung und Erziehung in der Schule. Eine ideengeschichtliche Untersuchung von Pestalozzi bis zur Kunsterzieherbewegung. München: Kopaed.
Sonderegger, Ruth (2019): Vom Leben der Kritik. Kritische Praktiken – und die Notwendigkeit ihrer geopolitischen Situierung. Wien: Zaglossus.
Sternfeld, Nora (2014): Verlernen vermitteln. Kunstpädagogische Positionen. Band 30. Hamburg: Hamburg Univ. Press.
Tervo, Juuso (2017): Education in the Present Tense. Paper presented at Dank Contemporaneities: One-Day Symposium on the Post-Internet. Online: https://hcommons.org/deposits/objects/hc:16212/data-streams/CONTENT/content [17.03.19].
Trabant, Jürgen (1971): Superman – Das Image eines Comic-Helden. In: Ehmer, Hermann K. (Hrsg.): Visuelle Kommunikation: Beiträge zur Kritik der Bewußtseinsindustrie. Köln: DuMont Schauberg, S. 251-276.

