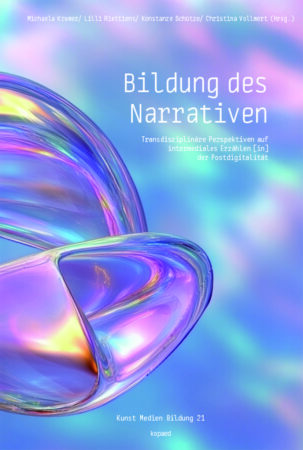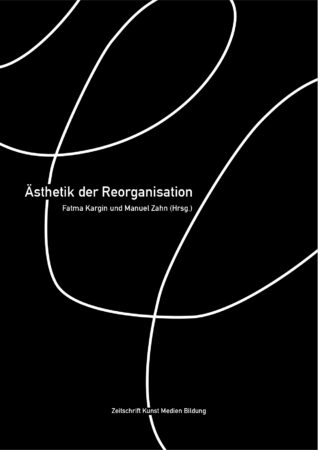Aktuell
Sammlungen
Kunstunterricht als Beitrag zu einem gelingenden Leben? Gesellschaftskritische Ansätze in der westdeutschen Kunstpädagogik zwischen 1970 und 1980
3. August 2025
Zwischen 1970 und 1980 wurden in der Geschichte der westdeutschen Kunstpädagogik erstmals verschiedene Zugänge zu populären und alltäglichen Phänomenen visueller Kultur abseits der Bildenden Kunst breit und vielfältig diskutiert. Als ausschlaggebend für die Ende der 1960er Jahre einsetzende Auseinandersetzung mit diesem neuen Themenfeld gilt Saul Paul Robinsohns 1967 erschienenes Buch Bildungsreform als Revision des Curriculums (Tewes 2018: 165). Robinsohn forderte darin die gesellschaftliche Relevanz fachlicher Inhalte im Unterricht und lieferte damit wichtige Impulse für die bestehenden Didaktiken insgesamt. Zur Debatte stand vor allem, „was von einem Schüler im Laufe seiner ‚Vollschulzeit‘ erfahren werden muß, damit er für ein mündiges, d.h. sowohl personell als auch ökonomisch selbständiges und selbstverantwortetes Leben so gut wie möglich vorbereitet sei“ (Robinson 1967: 46). Fachinhalte, so wurde gefordert, sollten insbesondere mit Blick auf eine emanzipatorische Entwicklung von Schüler*innen ausgewählt und aufbereitet werden.
Kritisch werden im Vermittlungskontext ästhetischer Erfahrungsräume. Zwei Beispiele aus der Repräsentationskritik
3. August 2025
Der Diskurs um Kritik in ästhetischen Erfahrungs- und Vermittlungsräumen hat vielgestaltliche Formen und Stränge mit je unterschiedlichen Schwerpunkten auf bereichsspezifische Teilaspekte. Beispielsweise die kritische Pädagogik und Erziehungswissenschaft mit Bezügen zur Kunst (siehe z. B. Klafki 1982, Mollenhauer 1972), die reflexive und emanzipatorische Kulturpädagogik (siehe z. B. Hoffmann 1981), ästhetische Zugriffe auf die Kritische Theorie (siehe z. B. Laner 2018), die Kulturwissenschaften (siehe z. Schade/Wenk 2011) oder die repräsentationskritische Kunstvermittlung (siehe z. B. Mörsch 2017) stellen unter verschiedenen, an manchen Stellen überlagernden, teils einander kontrastierenden oder ergänzenden Prämissen Kritik ins Zentrum. Der Komplex wird dabei an den einen Stellen als Forschungsgegenstand, an anderen Stellen als handlungsleitender Impetus oder als diese beiden Modi beziehend aufeinander behandelt und verwendet. Ein zeitgenössischer Blick auf den schulischen Bildungskontext und die neuen österreichischen Lehrpläne mit der expliziten, überfachlichen Aufforderung darin, kritisches Denken zu vermitteln, lässt die Notwendigkeit für gegenwartsbezogene, symptomatische Positionsbestimmungen aller in Vermittlungssituationen Beteiligter evident werden. Was muss der Vermittlung von kritischem Denken vorausgehen, um diese erfolgreich zur Umsetzung zu bringen, wann beginnt das Kritisch-Sein und wo liegen die Qualitäten ästhetischer Erfahrungsräume dabei?
Die folgenden Ausführungen gehen davon aus, dass bestimmte Fähigkeiten in ästhetischen Erfahrungsräumen geschult und verfeinert werden können. Diese meinen unter Rekurs auf Alexander G. Baumgarten beispielsweise scharfsinniges Empfinden, Vorstellungskraft sowie das Vermögen, gedanklich entworfenen und sinnlich wahrgenommenen Eindrücken Ausdruck zu verleihen (vgl. Baumgarten 1988). Im wiederholten Ausüben und Üben ästhetischen Erfahrens werden Prozesse des Lernens initiiert (vgl. ebd.), die unter dem Schirm ästhetischer Bildung auch, so die Leitlinie dieses Textes, das differenzierte Üben von Kritik und, mit Blick auf tradierte hegemoniale Selbstverständnisse, Sensibilität für Renovierungsbestrebungen epistemischer Kräfteverhältnisse vermitteln. Jene ästhetischen Erfahrungsräume, die hierin Behandlung finden, beziehen sich auf Umgebungen, in denen durch die rezeptive wie produktive Auseinandersetzung mit künstlerischen Artefakten und Ausdrucksformen eine Aneignung und Schärfung der eben genannten Fertigkeiten angebahnt werden können.
Ein neuer Turn? Kritik, Kunst, Vermittlung und Sorge
3. August 2025
In der Dezember-Ausgabe 2016 des Kunstmagazins Art Forum schreiben die Herausgeber*innen zum Thema des Hefts The Year in Shock: „Der verblüffende Aufstieg von Nationalismus, Populismus und Fundamentalismus hat die Welt in Aufruhr versetzt. Es ist verlockend, sich vorzustellen, dass wir nur Zeuge einer weiteren Wendung eines Zyklus von Fortschritt und Rückschritt in der politischen Moderne sind. Aber wir können den Untergang des Demos in der longue durée der Demokratie verorten und gleichzeitig den falschen Trost der Vorstellung zurückweisen, dass das, was geschieht, nicht neu ist, dass wir das alles schon einmal gesehen haben. Wie sind wir hierhergekommen?“ (Molesworth 2016: o. S.).
In ihrem Beitrag, der auf den Befund des „Untergangs des Demos der Demokratie“1 – den Verlust der politischen Handlungsmacht derjenigen, die zur Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen berechtigt sind, sei es durch Wahlen, Meinungsäußerungen oder andere Formen der Partizipation – reagiert, konstatiert die ehemalige Chefkuratorin des Museums für zeitgenössische Kunst in Los Angeles, Helen Molesworth, eine Wende, die sie als „neue Avantgarde“ beschreibt. Diese greift, im Gegensatz zur historischen Avantgarde, nicht auf die Taktik zurück, dem Schock der Moderne durch künstlerische Schockmittel zu kontern. Stattdessen, so Molesworth, bevorzugen zeitgenössische Künstler*innen eine fürsorgliche Haltung, geprägt von kontinuierlicher Selbstreflexion und Rücksichtnahme auf andere.
Kunstvermittlung zwischen Rationalismus und Bildung
3. August 2025
Der Bildung sind keine Grenzen gesetzt, dem Begriff der Bildung schon. Wer die Grenzen des Deutschsprachigen überschreitet, findet sich weiterhin in Ländern wieder, wo gelehrt und unterrichtet wird, nur wird der Begriff der Bildung fehlen und ersetzt sein durch andere traditionelle Vokabeln, die sich entweder aus dem lateinischen Substantiv für Erziehung, educatio, gebildet haben oder eigenen Sprachtraditionen gefolgt sind, wie im Niederländischen der Begriff vorming, zu Deutsch Formung, Durchformung, im Sinne von Bildung. Nun enthält dieser letzte Satz bereits zahlreiche komplexe Implikationen, die eine Übersetzung wiederum schwer machen würden. Habe ich den Begriff der Bildung bereits in Anspruch genommen, wenn ich sage, etwas habe sich gebildet, in diesem Fall sprachlich, über Generationen hinweg? Der aufklärerische Bildungsbegriff, mit seinem Fokus auf das sich selbst bildende, freie Individuum, kann hierauf nicht angewandt werden. Und doch stehen überindividuelle, sich bildende Prozesse im Hintergrund zur Befähigung des oder der Einzelnen, sich selbst bilden zu können.
Wer hat Angst vor Kommune, Kollektiv und Kooperation? Eine kunstpädagogische Kritik an der Documentakritik.
3. August 2025
Wie die vehemente (deutschsprachige) Kritik an der documenta fifteen verdeutlicht hat, tut sich das Kunstsystem bis heute schwer, künstlerische Verfahren anzuerkennen, die auf Kollektivität beruhen. Kunstpädagogische Arbeit ist aber vor allem das: Zusammenarbeit mit anderen. Kunstvermittlung findet zumeist in Gruppen statt und hat idealiter ästhetischen Gemeinsinn zum Ziel.
Weil weder Autor*in noch Werk für das Publikum in gewohnter Weise greifbar werden, scheinen kollektive künstlerische Praxen in besonderer Weise dazu aufzufordern, sich mit kunstinstitutionellen Gepflogenheiten und eigenen Erwartungen auseinanderzusetzen und für selbstverständlich gehaltene Kunstverständnisse in den Blick zu nehmen. Die anhaltend heftigen kritischen Reaktionen auf die documenta fifteen schienen mir insofern geeignet, um sie einer diskursanalytischen Untersuchung aus kunstvermittelnder Perspektive zu unterziehen. Entlang der Frage, wie über die documenta fifteen gesprochen und geschrieben wurde, war ich interessiert daran, mehr über die Vorannahmen und Kriterien der Beurteilung zu erfahren, die zur Durchsetzung eines Kunstbegriffs beigetragen haben, der, wenn nicht dominant, so doch wirkmächtig seine Verbreitung findet.
Kritik an Dingen. Oder die Frage nach den Voraussetzungen von Bildungsprozessen durch die kritische Auseinandersetzung mit Dingen des Alltags
3. August 2025
Bildungstheoretische Auseinandersetzungen im deutschsprachigen Raum fassen Bildungsprozesse als individuellen, häufig auch als subjektiven Prozess. Bildung ‚passiert‘ (Bildung als Widerfahrnis) dem Individuum in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst, den*m Anderen und der Welt. Bildungsprozesse können daher nicht geplant oder in einem starken Sinne angeleitet werden. (Vgl. u.a. Mollenhauer 2008, Benner 2015) Auch ist nicht abzusehen, wie sich das durch Bildung (trans-)formierte Subjekt ‚ausrichten‘ wird (Bildung ohne Ziel). (Vgl. etwa Adorno 2003, Mollenhauer 2008) Bildung ist ein äußerst fragiler und riskanter Prozess, der das Bildungssubjekt als solches herauszufordern vermag. Dieses muss dementsprechend offen für jene (Trans-)Formationen durch Bildung sein. Es braucht einen Safe Space, um sich in dieser Art und Weise selbst und seine Welt riskieren zu können. Im Kontext von Bildung wird dementsprechend eine spezifische ‚Haltung‘ von Bildungssubjekt vorausgesetzt. Eine Haltung, die ein Offen-Sein gegenüber sich selbst, dem*n Anderen und der Welt anzeigt.
Wissen entrücken. Reflexion als kritische Geste
3. August 2025
„Hier finden ästhetische Erfahrungen statt.“ Eine Feststellung, die Beobachtbarkeit suggeriert und zugleich Fragen aufwirft: Woran wird dies erkennbar, ableitbar, vermutbar? Zum Kern kunstpädagogischer Praxis zählen initiierte Settings, in denen andere sich situativ erproben können, etwas erfahren können. Diese Inszenierungen werden zumeist von Unterstellungen oder einem Anspruch getragen, dass z.B. ästhetische Erfahrungen möglich werden. Doch ist dieses Vorhaben so einfach, wenn Erfahrungen etwas sind, das sich nicht beobachten lässt (vgl. Sabisch 2009: 14)?
Verstehen wir ästhetische Erfahrungs- und Bildungsprozesse als unverfügbare wie zugleich zentrale kunstpädagogische Momente, kann dieses ambivalente Verhältnis einen spezifischen Zugang herausfordern, um uns als Fragende und Suchende im kunstpädagogischen Feld zu situieren. Operiert das, was unser kunstpädagogisches Interesse auf sich zieht, im Entzug, können wir in einer reflexiven Hinwendung versuchen, Figurationen und Konstellationen zu entschälen oder zu entwickeln, die symptomatisch auf Erfahrungs- und Bildungsprozesse verweisen. Diese indirekte Annäherung an Erfahrungs- und Bildungsprozesse bemüht sich um eine Arbeit mit dem Un(ver)fügbaren, betrachtet dies als konstitutiv und suggeriert nicht die Auflösung des Un(ver)fügbaren. Vielmehr wird in der Akzeptanz des vorherrschenden Entzugs ein Bezug anderer Art möglich: Indem wir anerkennen, dass sich Erfahrungs- und Bildungsprozesse nicht direkt beobachten lassen, können wir unsere Aufmerksamkeit auf Symptome dieser Prozesse richten: „Auf Symptome greift zurück, wer auf die Sache selbst nicht Zugriff hat und nur indirekt Rückschlüsse über das zu ziehen vermag, was ihm vorliegt.“ (Alloa 2011: 273)
Fachdidaktische Überlegungen zu einer Kunstpädagogik der Übergänge und Multiperspektivität am Beispiel einer „kongolesischen Kraftfigur“ um 1900 – oder: vielfältige Narrative über eher unbekannte Objekte
3. August 2025
„Ich zweifle grundsätzlich daran, dass es eine Wahrheit, eine Geschichtsnarration oder eine Autorschaft gibt. Mich interessiert das Dazwischen.“ Mathilde ter Heijne
Das Konzept der Salzburger Tagung „Kritik (in) der Kunstpädagogik“ fragte nach Formen, Relationen und Potentialen des Kritisierens im Rahmen der Disziplin Kunstpädagogik. Zugänge einer sogenannten „kritischen Kunstpädagogik“ standen dabei zur Diskussion, gleichwohl aber auch eine Kunstpädagogik, die sich reflexiv mit Aspekten von Kritik beschäftigt. Eine Frage, die vor diesem Horizont für das Folgende insbesondere relevant erscheint, war jene nach Perspektivierungen des Kritisierens im Rahmen der Fachspezifik: Welche Aspekte des Kritisierens sind unter einem fachdisziplinär ausgerichteten, kunstpädagogischen Zugang relevant? Eine Möglichkeit des Antwortens wäre: kritische Zugänge der Kunstpädagogik in Relation zu Normativität und Reflexivität zu setzen.
Sammlungen
6. August 2025
Narratives ist seit jeher zentral für die menschliche Welterschließung – es verknüpft Kulturen, überdauert Zeit und Raum und prägt unser Verständnis von Wirklichkeit. In der Postdigitalität stellen sich nun Fragen danach, wie digitale Technologien und Künstliche Intelligenz das Narrative verändern. Wer bestimmt, welche Geschichten erzählt werden und wie erzähle ich mich selbst in einer komplexen Welt? Dieser Band versammelt in sieben Kapiteln transdisziplinäre Beiträge, die sich entlang der Denkfiguren Bildung, Geschichte/n und Doings bewegen und dabei neue Perspektiven auf postdigitale Narrative eröffnen.
3. August 2025
Die Textsammlung „Kritik (in) der Kunstpädagogik“ versammelt Beiträge, die das Verhältnis von Kritik, Reflexion und Handeln im kunstpädagogischen Feld aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass kritisches Denken nicht nur untrennbar mit Prozessen der (Selbst-)Befragung verbunden ist, sondern auch sich auch stets als Handeln aktualisiert – insbesondere in einem Feld, das sich mit Fragen von Ästhetik, Repräsentation und gesellschaftlicher Verantwortung auseinandersetzt. Die Autor*innen verfolgen das Ziel, Kritik nicht als abstrakte Theoriefigur, sondern als situierte, verkörperte und oft kollektiv getragene Praxis zu fassen.
Dabei werden normative Rahmungen kunstpädagogischer Kritik und Reflexion (Hoffmann), das Potenzial des „Zwischenraums“ für kritische Auseinandersetzung (Johns), sowie alltagsnahe Kritikformen im Umgang mit Dingen (Zobl) ebenso thematisiert wie die Herausforderung kollektiver Autor*innenschaft und Verantwortung im Kontext aktueller Kunstdiskurse (Puffert). Weitere Beiträge analysieren die Rolle institutioneller Prägungen und tradierter Begriffe in der Kunstvermittlung (Mühleis), den Einfluss fürsorglicher und ethisch reflektierter Haltungen auf kritische Vermittlungsarbeit (Mahlknecht) sowie das Verhältnis von Repräsentationskritik, Partizipation und Verlernen in ästhetischen Erfahrungsräumen (Schitter). Ein historischer Rückblick auf die 1970er Jahre (Sturm) verdeutlicht schließlich, wie Kritik als kunstpädagogische Praxis stets mit gesellschaftlichen Bewegungen und bildungspolitischen Fragen verwoben ist.
Die Sammlung plädiert insgesamt für eine Kunstpädagogik, die Kritik nicht als distanzierte Bewertung, sondern als prozessuales, zugewandtes und kontextsensibles Handeln versteht – ein Handeln, das sich den Spannungen zwischen Wissen und Nichtwissen, Verantwortung und Ambivalenz, Institution und Subversion stellt.
11. Februar 2025
Ausgehend von den jüngeren ästhetischen Schriften des amerikanischen Philosophen Alva Noë, insbesondere seiner Theoriefigur der Reorganisation subjektiver Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen, suchen die Autor*innen des Sammelbands nach produktiven Anschlüssen für die Ästhetische Bildung, die Kunstpädagogik und Kunstvermittlung.
Noës Theorie ästhetischer Erfahrung konzipiert dieselbe als ein transformatives, in seinen Worten, als ein reorganisierendes Ereignis. In erkenntnistheoretischer Perspektive bedeutet das für ihn, dass wir als Menschen nur Anderes wahrnehmen und erkennen können, wenn wir anders als zuvor wahrnehmen und erkennen; und wir können nur anders erkennen, wenn wir uns im Prozess der ästhetischen Erfahrung reorganisieren, eben selbst in einem gewissen Maße Andere werden. Die Kunst, so seine These, stellt hierfür emanzipative ,Werkzeuge‘ zur Verfügung. Und sie tut es in einem komplementären, verflochtenen Verhältnis zu unseren alltäglichen und habitualisierten Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen. Die Kunst habe nach Noë einerseits das Potenzial, die Art und Weise, wie wir als individuelle Subjekte organisiert sind – durch verkörperte Gewohnheiten sowie historische, sozio-kulturelle und technologische Strukturen – thematisch werden zu lassen und so zu einer gesteigerten Selbstwahrnehmung zu führen. Andererseits stellt sie den Subjekten ästhetischer Erfahrung alternative, andere Praktiken und Weisen des Wahrnehmens, Denkens und Handelns zur Verfügung. Dabei eröffnet seine Theorie neue Zugänge zum Verständnis ästhetischer Bildungsprozesse bzw. ermöglicht sie den bildungstheoretisch interessierten Leser*innen Fragen zu stellen, beispielsweise hinsichtlich der Anlässe von ästhetischen Erfahrungen, ihrer Verlaufsform und nicht zuletzt auch bezüglich der Verflochtenheit von Individualität und Kollektivität ästhetischer Erfahrung.
Die Beiträge nähern sich auf ganz unterschiedliche Weise der ästhetischen Theorie von Alva Noë: Sie diskutieren sie kritisch hinsichtlich ihrer Grenzen, vergleichen sie mit anderen ästhetischen und wahrnehmungstheoretischen Positionen, erproben sie in Bezug auf verschiedene medienspezifische Kunsterfahrungen oder erweitern sie. Die Autor*innen greifen dabei die zuvor in bildungstheoretischer Perspektive formulierten Fragen auf oder werfen andere weiterführende Fragen auf.