Kritik an Dingen. Oder die Frage nach den Voraussetzungen von Bildungsprozessen durch die kritische Auseinandersetzung mit Dingen des Alltags
Kein Ding, Digga, das Ding hat Swing. Dinge geben Kingdom, Dinge nehmen alles.
Deichkind (2019): Dinge
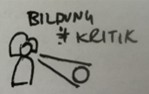
Abb. 1
Bildung, Kritik und Dinge – Eine Verhältnisbestimmung
Bildungstheoretische Auseinandersetzungen im deutschsprachigen Raum fassen Bildungsprozesse als individuellen, häufig auch als subjektiven Prozess. Bildung ‚passiert‘ (Bildung als Widerfahrnis) dem Individuum in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst, den*m Anderen und der Welt. Bildungsprozesse können daher nicht geplant oder in einem starken Sinne angeleitet werden. (Vgl. u.a. Mollenhauer 2008, Benner 2015) Auch ist nicht abzusehen, wie sich das durch Bildung (trans-)formierte Subjekt ‚ausrichten‘ wird (Bildung ohne Ziel). (Vgl. etwa Adorno 2003, Mollenhauer 2008) Bildung ist ein äußerst fragiler und riskanter Prozess, der das Bildungssubjekt als solches herauszufordern vermag. Dieses muss dementsprechend offen für jene (Trans-)Formationen durch Bildung sein. Es braucht einen Safe Space, um sich in dieser Art und Weise selbst und seine Welt riskieren zu können. Im Kontext von Bildung wird dementsprechend eine spezifische ‚Haltung‘ von Bildungssubjekt vorausgesetzt. Eine Haltung, die ein Offen-Sein gegenüber sich selbst, dem*n Anderen und der Welt anzeigt. [1]
Offene Bildungsprozesse von Subjekten brauchen dementsprechend ein Gegenüber, das diese Offenheit allererst ermöglicht. So kann nicht immer von Bildung bzw. von einem Bildungsprozess in diesem engeren Sinne gesprochen werden. Das Selbst, das Andere und die Welt brauchen eine gewisse Opazität, eine Unschärfe, die die Richtung einer solchen (Trans-)Formation offen zu lassen vermag. Bildung ‚passiert‘ so nach gegenwärtigen Theorielagen am Unerwarteten, am Negativen oder auch am Fremden. (Vgl. etwa Benner 1999, Koller 2010, Schäfer 2020) Nach deutscher Tradition eignen sich dafür vorrangig die Beziehung zu sich selbst und den Anderen. Wenn es sich um Dingliches im weitesten Sinne dreht, dann bildet sich das Bildungssubjekt vorrangig beim Reisen (vgl. Humboldt 1903-1936, Goethe 1976, Rousseau 2003) – als bewusste Auseinandersetzung mit der fremden kulturellen und somit auch dinglichen Welt – und anhand von Kunst (vgl. Goethe 1976, Schiller 1984) – als Auseinandersetzung mit für das Bildungssubjekt nicht eindeutig einordenbaren Visualisiertem, Konzepten und Dingen.
Kritikfähigkeit, verstanden als die Fähigkeit zur differenzierten und zielgerichteten Auseinandersetzung und Urteilsbildung in Bezug auf das Selbst, die*das Andere*n und die Welt (vgl. Foucault 1992), kann eine wichtige Voraussetzung für Bildungsprozesse sein. Kritikfähigkeit ermöglicht dem Bildungssubjekt eine andere Form der Betrachtung des jeweilig gegenübergestellten, das auch eine kritische Betrachtung des eigenen Selbst umfassen kann. In seinem viel beachteten Vortrag Was ist Kritik? fasst Foucault Kritik in Anlehnung an Kants Überlegungen als Mut der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen, als Haltung und Tugend, jedoch aus als Reflektieren der Reichweite des eigenen Wissens. (Foucault 1992: 16-17) Foucault schreibt über die Kritik, dass diese als Funktion verstanden werden kann: „Schließlich existiert die Kritik nur im Verhältnis zu etwas anderem als sie selbst: sie ist Instrument, Mittel zu einer Zukunft oder zu einer Wahrheit, die sie weder kennen noch sein wird, sie ist ein Blick in einen Bereich, in dem sie als Polizei auftreten will, nicht aber ihr Gesetz durchsetzen kann.“ (Ebd. 10). Kritik ist, so Foucaults bekannte Formel, „die Kunst nicht dermaßen regiert zu werden“ (ebd. 12). Die kritische Haltung befähigt das Subjekt sich zu sich selbst, zu Anderen und die es umgebende Welt in ein anderes Verhältnis in Bezug auf Wahrheit, Recht und Autorität zu setzen (ebd. 12-14).
Kritik wird – in dieser Weise verstanden – als eine spezifische Haltung aber auch Praxis des Subjekts gefasst. Braucht die Bildung vor allem Offenheit, so kann die Haltung des kritischen Subjekts als aktiv, mutig und wissbegierig (Foucault 1992: 17-18) beschrieben werden. Im Gegensatz zur Bildung ist Kritik zielgerichtet, d.h. sie richtet sich konkret ‚gegen‘ etwas oder jemanden. Befrage (selbst) deine eigenen und fremde Wahrheitsansprüche, Gesetze und Gesetzmäßigkeiten und die Macht von Autorität – so die Imperative ausgehend von Foucaults Kritikverständnis. Kritik ist in diesem Sinne dem Individuum vorbehalten, kann also nicht stellvertretend für andere vollzogen werden. Dies deckt sich mit dem Verständnis von Bildung, die ebenso vom Subjekt aus zu denken ist. Bildung und Kritik können und sollen so im Folgenden in ein direktes Verhältnis gebracht werden, auch wenn Kritik Bildung nicht notwendig nach sich zieht oder diese in jedem Fall voraussetzt. Das heißt, das Machen von bildenden Erfahrungen verlangt vom Bildungssubjekt auf jeden Fall das Einlassen auf jene Erfahrungen, kann jedoch auch durch die kritische Auseinandersetzung mit dem Selbst, den Anderen und der Welt begünstigt werden.
Dinge, die nicht im Kontext des Reisens oder der Kunst eingebettet sind bzw. sich für das Subjekt weder fremd, anders oder ‚negativ‘ darstellen, können – so die These dieses Artikels – über das Moment von Kritik für potenzielle Bildungsprozesse fruchtbar gemacht werden. Die Dinge, um die es in diesem Artikel gehen soll, sind Dinge des Alltags. Vom High-Tech-Fernseher mit KI unterstützter Browser-Funktion, über die mechanisch funktionierende Salatschleuder bis zum Teststreifen zur Bestimmung des pH-Wertes des Babybades, sind es gerade jene Dinge, die das individuelle und gesellschaftliche Leben in einem starken Sinne prägen[2]. Sie regieren uns. Besonders gut nachvollziehbar zeigt sich die Wirkmächtigkeit dieser Dinge bei den ‚neuen‘ Kommunikationstechnologien, nämlich den sogenannten Smartphones. Als ‚verbesserte‘ und ‚optimierte‘ Variante des bereits etablierten Festnetz-Telefons, des Computers, der Spielekonsole, der Musikanlage, des Buchs etc. verbringen Menschen mittlerweile viele Stunden des Tages damit, sich mit ihren Smartphones zu beschäftigen. Neben Verhaltensänderungen, die das individuelle und gemeinschaftliche Leben nachhaltig geprägt haben, kommt es durch den Gebrauch des Smartphones auch zu psychologischen und physiologischen Anpassungen und Beeinträchtigungen von Personen. (vgl. Newport 2019). Dinge des Alltags haben eine machtvolle Wirkung auf das (gute) Leben von Subjekten und Gemeinschaften. Es scheint also unerlässlich, diese als Ausgang von Bildungsprozessen verstehen zu wollen. Dinge haben nur leider einen Makel: Als Teil des Alltags, stehen solche Dinge den potenziellen Bildungssubjekten nicht als Fremde, Andere oder Negative gegenüber. Dinge sind dermaßen im Leben der Subjekte integriert, dass diese nur unter bestimmten Umständen als potenziell kritisierbares Gegenüber des Subjekts in Erscheinung treten können: nämlich wenn sie nicht länger funktionieren oder in unerwarteter Weise funktionieren. Aber auch hier ist es meist eher ein (unkritisches) Ärgernis, das den Dingen entgegengebracht wird, als eine kritische Auseinandersetzung mit dem Ding an sich. Kritik als aktive, mutige und wissbegierige Haltung des Subjekts soll im Folgenden demnach so gegenüber Dingen praktizierbar gemacht werden, dass diese im besten Fall Bildungsprozesse auslösen können.
Für ein solches Vorhaben soll zunächst das problematische Verhältnis von Bildung zu jenen Alltagsdingen nachgezeichnet werden. Es soll die Frage geklärt werden, warum Alltagsdinge im Gegensatz zu Dingen der Kunst und des Reisens nicht in einem für Bildungsprozesse angemessenen Verhältnis zum Bildungssubjekt stehen und was es dafür brauchen könnte. Die Objektivierung bzw. Relationierung von Alltagsdingen wird dabei in mehreren Schritten durchgedacht. Im Anschluss an die Klärung dieser Frage geht es um die Dinge an sich. Eine nähere Bestimmung des Dingbegriffs erscheint notwendig. Es zeigt sich, dass Dinge nicht nur als ‚Technische‘ verstanden werden können, sondern als sogenannte Hybride bereits auch Teil des ‚Natürlichen‘ geworden sind. Wird im Folgenden von Alltagsdingen geschrieben, umfassen diese beide Kategorien, d.h. technische Dinge (Werkzeuge), technisch hergestellte Dinge (Dinge des Alltags aus Low und High Tech) und Hybride (Dinge, die ‚lebendige‘ Anteile aufweisen, wie bspw. KI). Ansonsten wird zwischen hybriden Dingen oder ‚einfachen‘ Dingen bzw. Heideger’schen Dingen gesprochen. Diese Unterscheidung ist vor allem dann noch einmal wichtig, wenn man nach dem Wie von Kritik fragt, die Bildungsprozesse für Subjekte anhand von Dingen voraussetzen könnte. Die dafür benötigte neue Verhältnissetzung von Subjekt, Funktion und einem angemessenen Kontext zeigt sich bei hybriden Dingen leicht verschoben zu den einfachen Dingen des Alltags. Bis dahin bewegt sich der Text eng am klassisch intellektualistisch angelegten Bildungsbegriff und antwortet dementsprechend mit einer intellektualistischen Form von Kritik. Am Ende des Beitrags werden Foucaults Überlegungen zur Kritik hinsichtlich der kritischen Praxis der antiken Kyniker*innen noch einmal zugespitzt. In Anbetracht der Frage nach einer Form von Kritik, die im praktisch agierenden Bildungswesen anschlussfähig ist und anhand des Umgangs mit Dingen ihren Ausgang findet, braucht es eine solche andere Herangehensweise. Schüler*innen sollen im Gegensatz zu den anleitenden Lehrenden ins Zentrum gerückt werden. Eine solche Form von Kritik bzw. eine kritische Praxis kann es dem Bildungssubjekt, sprich den Schüler*innen, einerseits ermöglichen, direkte Erfahrungen mit den Alltagsdingen zu machen, und andererseits durch die Verhältnisverschiebung der Dinge zu sich selbst und der Welt potenziell Bildungsprozesse auslösen.
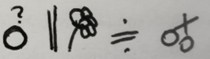
Abb. 2
Bildung und Dinge – Eine kurze Problembestimmung
So offen deutschsprachige Bildungstheorien mit dem Ausgang von Bildungsprozessen anhand der Verhältnissetzung von Selbst, Anderen und Welt erscheinen mögen, so kompliziert wird es in der Detailbetrachtung. Bildende Erfahrung kann nach gängigen deutschsprachigen Bildungstheorien zwar immer und überall gemacht werden, jedoch – und hier wird es kompliziert – nicht anhand von allem. Gerade in der Auseinandersetzung mit der materiellen Welt, sprich auch den Dingen – im Gegensatz zur Auseinandersetzung mit der eigenen Subjektivität und anderen Subjekten – wird häufig Bildungspotenzial abgesprochen. Warum ist das so? Zur Beantwortung der Frage soll zunächst zwischen Dingen und Objekten unterschieden werden. So sind Dinge im Gegensatz zu Objekten (noch) keine relationalen Gegenüber des Selbst, die bereits in einem bewusst reflektierbaren oder auch kritisierbaren Verhältnis zu diesem stehen. Obwohl Subjekte zwar ständig mit Dingen hantieren, stehen diese nicht in einer bewusst reflektierbaren Beziehung (Relation) zu diesen. Was paradox erscheinen mag, erschließt sich beim Nachdenken über den eigenen Alltag. Dinge sind durch ihre Funktion (Waschen, Kaffee-Machen, Messen etc.) so vertraut, dass wir in den meisten Fällen nur die Funktion an sich – funktioniert oder funktioniert nicht – aber nicht das Ding selbst in den Blick nehmen. Wer denkt schon über die Sickergeschwindigkeit und ihre Veränderbarkeit bei Kaffee-Maschinen nach, obwohl dadurch der Kaffeegenuss an unsere individuellen Bedürfnisse angepasst werden könnte? Oder über differenziert und aufwendig zu bedienende und zu wartende Dinge des Alltags, auch wenn diese uns unnötig Stress bereiten? Wir ärgern uns maximal über die aufzuwendende Zeit, jedoch fragen wir uns kaum, was jene Dinge mit uns zu tun haben und wie diese durch ihre Machart unser eigenes Leben und die Gesellschaft verändern.
Relationalität in Bezug auf die Form eben der Beziehung zum Subjekt zeichnet sich also dadurch aus, dass sich das Subjekt allererst bewusst über das Da-Sein eines Gegenübers und dessen Veränderbarkeit im Verhältnis auf sich selbst, auf die Anderen und die Welt ist. Dinge sind dem Subjekt im Gegensatz zu den Objekten – so könnte man sagen – noch zu (!) fremd, als dass diese als Gegenüber in Erscheinung treten können. Bildungsprozesse sind dadurch ausgeschlossen. Auch eine bewusste kritische Haltung ihnen gegenüber ist damit nicht möglich. Dinge werden vom Subjekt zwar auf leiblicher Ebene erfahren[3], jedoch noch bevor diese von ihm potenziell erkannt werden können, also als Objekte in Relation zum eigenen Ich gebracht werden können (Roßler 2016: 78). Subjekte sind ‚blind‘ gegenüber den Dingen des Alltags, obwohl diese ständig mit ihnen umgehen (müssen). Bildung braucht nach gängigem deutschsprachigen Verständnis – so möchte ich zunächst zu bedenken geben – demnach die Auseinandersetzung mit Objekten und nicht mit Dingen, um bildende Erfahrungen für die Subjekte zu ermöglichen.
Wie werden Dinge zu Objekten? Warum technisch hergestellte Dingen vordergründig keinen Objektstatus besitzen und wie dies geändert werden kann, lässt sich entlang der Gedanken von Heidegger zeigen, der die deutschsprachige Bildungstheorie stark prägt(e). Er zeigt einen Weg auf, unter welchen Umständen Dinge potenziell zum Objekt werden können. In seiner Analyse der Dingwelt unterscheidet Heidegger zwischen „vorhandenen“ und „zuhandenen Dingen“ (Heidegger 2006: 118). Während vorhandene Dinge sich einer bewussten subjektiven Erfahrbarkeit bzw. Erkennbarkeit entziehen, wie der Begriff bereits nahelegt, hat das Subjekt auf zuhandene Dinge – diese können über Hand und Geist ‚begriffen‘ werden – erkenntnistheoretischen und pragmatischen ‚Zugriff‘. Heideggers zuhandene Dinge können also nach dieser ersten Definition als Objekte verstanden werden. Wie werden nun aber nach Heidegger aus Dingen Objekte?
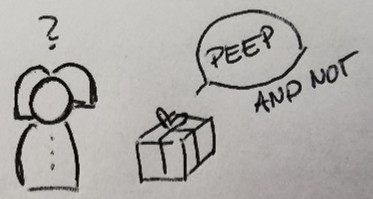
Abb. 3
Vom Ding zum Objekt – Begriffsbestimmung und Transformation
Dinge müssen, um Bildungsprozesse für Subjekte zu ermöglichen, zum Objekt werden, um in eine angemessene Relation zum Subjekt treten zu können. Denn das Subjekt braucht nach gängigen deutschsprachigen Bildungstheorien neben der leiblichen Interaktionsmöglichkeit mit dem ‚bloß‘ vorhandenen Ding noch etwas anderes, damit dieses für das Subjekt zum Objekt werden kann.
Doch wie ist dies möglich? Heidegger bringt eine Eigenschaft von Dingen ins Spiel, die auf analytischer Ebene zwischen Ding und Objekt, oder wie er schreibt zwischen „vor-und zuhanden“ unterscheiden lässt: die Funktionalität (Heidegger 2006: 69). Ein technisches Ding, wie ein Werkzeug, wird nach Heidegger erst dann zuhanden, d.h. als Objekt vom Subjekt erkennbar, wenn es nicht länger funktioniert, d.h. wenn es defekt ist. Eine Greifzange beispielsweise, um Heideggers Überlegungen plastischer werden zu lassen, wird für das Subjekt als Zuhandenes erfahrbar, wenn diese ihre Funktion des Greifens nicht länger ausführt. Wie die Dinge der Kunst werden so auch die Dinge des Alltags für das Subjekt unmittelbar funktionslos. Diese können nun vom Subjekt nach eigenem Ermessen und unter neuen Umständen ins Verhältnis zu sich selbst gesetzt werden. Alltagsding und Subjekt stehen durch die Funktionslosigkeit des Dings in einem neuen, veränderten Verhältnis, das ihm den erkennenden Zugriff ermöglicht.
Denkt man Heideggers Analyse weiter, dann kann man sagen, dass sich die Greifzange durch ihre Dysfunktion dem Subjekt als auf leiblicher Ebene widerständige entgegensetzt und somit erst deshalb für das Subjekt in Erscheinung treten kann. Die Greifzange dient nicht länger zum (kraftverstärkenden) Greifen. Sie ist für den Moment funktionslos und könnte gerade deshalb vom Subjekt mit neuen eigenlogischen ‚Funktionen‘ überformt werden. Das Greifen weicht beispielsweise einem Schlagen, wie mit einem Hammer oder wird sogar zum Halten der Vorhänge im Wohnzimmer verwendet. Die Eindeutigkeit des Dings ist einer Vieldeutigkeit des Objekts gewichen. Die Greifzange wird durch ihren Funktionsverlust vom eindeutigen und unsichtbaren Gebrauchsding zum Objekt.
Während vorhandene Alltagsdinge – wie Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände – funktionieren, sich in den leiblichen Alltag des Bildungssubjekts integrieren und somit als Objekte für das Subjekt ‚unsichtbar‘ sind, funktionieren zuhandene Dinge nicht länger in einer eindeutigen Weise und können somit nach Heidegger zur leiblichen und geistigen Herausforderung für das Subjekt werden. Anders ausgedrückt kann man auch sagen, jene Dinge sind nicht länger Mittel zum eindeutigen Zweck[4]. Erst wenn diese ihre Zweckmäßigkeit verlieren, können sie als Objekte in den subjektiven Blick geraten und isoliert vom praktischen Nutzen für das Subjekt betrachtet werden. Die Seinsweisen – um im phänomenologischen Jargon zu bleiben – von Dingen sind also, wenn überhaupt, nur indirekt, nämlich über das defekte Ding, für das Subjekt erfahr- und erkennbar. Um Bildungsprozesse anhand von und gegenüber Dingen allererst denken zu können, müsste das Bildungssubjekt also für ihre Objektivierung eine Dysfunktionalität von Dingen bedingen, so die vorläufige Conclusio in Anschluss an die Überlegungen von Heidegger. Reicht das?
Heideggers Verwandlung von Dingen zu Objekten durch den Funktionsverlust ist nur auf den ersten Blick für das Ansinnen dieser Arbeit im vollumfänglichen Sinne tragfähig. Denn der Objektstatus ist bei Heideggers zuhandenen dysfunktionalen Werkzeugen und im bildungstheoretischen Kontext lediglich ein schwacher, so möchte ich zu bedenken geben. Das heißt, dysfunktionale Dinge stehen zwar in einem relationalen Verhältnis zum Subjekt, jedoch reicht diese Form der Beziehung nicht aus, um bildungstheoretisch relevant zu sein. Dinge verursachen vorrangig eine emotionale Antwort beim Bildungssubjekt, einen Affekt, jedoch keine Aufforderung zur differenzierten Auseinandersetzung mit diesem[5]. Die Relationalität, d.h. die bewusste Erfahrbarkeit des dysfunktionalen Alltagsdings, umfasst auch bei seinem Versagen lediglich die Funktionalität und nicht die Machart und -weise des Alltagdings und ihren Auswirkungen auf das Selbst, die Anderen und die Welt. In Anlehnung an den Designtheoretiker Burckhardt kann gesagt werden, dass „das Design“ und damit die Machart und -weise der Alltagsdinge „unsichtbar“ für den*die Nutzer*in ist und bleibt: „Unsichtbares Design. Damit ist heute gemeint: das konventionelle Design, das seine Sozialfunktion selber nicht bemerkt. Damit könnte aber auch gemeint sein: ein Design von morgen, das unsichtbare Gesamtsysteme, bestehend aus Objekten und zwischenmenschlichen Beziehungen, bewusst zu berücksichtigen imstande ist.“ (Burckhardt 1980: 217) Design meint nach Burckhardt also gerade nicht die Funktion oder Dysfunktion von Alltagsdingen, sondern eben die mannigfaltigen Auswirkungen jener Dinge auf das Selbst, die Anderen und die Welt durch die Art und Weise, wie es im Designprozess angelegt wurde. Um dem Problem der Unsichtbarkeit der Machart von Dingen zu begegnen, plädiert er an Designer*innen reflektierter und kritischer an Entwürfe und Umsetzung von Dingen heranzugehen (vgl. 217). Der kritische Zugriff auf Dinge bleibt so auf der Seite derjenigen, die jene Alltagsdinge entwerfen und produzieren. Das Problem der Unsichtbarkeit von Alltagsdingen für potenzielle Bildungssubjekte wird aber nicht bearbeitbar.
Vergleicht man zudem das Bildungspotenzial von Dingen im Kontext der Kunst und des Reisens mit jenem von dysfunktionalen Dingen des Alltags, dann zeigt sich, dass der Grad der Bedeutungsoffenheit für das Subjekt in einem Missverhältnis zu Gunsten der Dinge des Reisens und der Kunst steht. Man könnte auch sagen: Eine Zange bleibt für das Subjekt eine Zange, auch wenn diese im Alltag nicht funktioniert. Erst die Kunst vermag – das plumpe Beispiel ist zu entschuldigen – die Zange in einem künstlerischen Prozess zur Vase zu machen und damit für das produzierende und auch rezipierende Subjekt als Ausgang von Bildungsprozessen zu erschließen. Wo liegt aber nun der Unterschied zur Heidegger’schen Zange, die als Vorhanghalter verwendet wurde? Auch hier wurde das Ding mit einer neuen Funktion überformt. Mit einem Blick auf die Dinge des Reisens zeigt sich, dass es nicht nur um den Befremdungsprozess geht. Denn auch beim Reisen in fremde Länder und Regionen beobachten und verwenden wir Dinge, die funktionieren. Dennoch sind diese bildungstheoretisch relevant. Bei gleicher Funktion sehen Alltagsdinge dort (etwas) anders aus, werden (etwas) anders verwendet oder werden im anderen Rahmen von uns oder den Anderen zum Einsatz gebracht. Die koreanische Küche, beispielsweise, verwendet beim Kochen und zum Vorbereiten des Verzehrs von beispielsweise Tintenfisch-Suppe eine Küchenschere, um das Tier prominent am Esstisch für die Hungrigen zu zerkleinern. Auch wenn diese Entscheidung im pragmatisch-funktionalen Sinne nachvollziehbar ist, befremdet der Einsatz von Scheren in einem solchen Kontext den europäisch geprägten Menschen. Fast unweigerlich kommt es bei den meisten zu einem Nachdenken und Sprechen über die Esskultur in einem breiteren Sinn. Beim Reisen, so die deutschsprachige Bildungstheorie, ist es dem Subjekt gerade durch die Bedeutungsverschiebung, in denen Alltagsdinge verwendet werden, möglich Dinge zu erkennen und sich anhand derer zu bilden. (Vgl. Ruprecht 2021)
Den Unterschied zwischen Dingen der Kunst, Dingen des Reisens und Dingen des Alltags macht hier in einem starken Sinne die Kontextualisierung, d.h. die Rahmung, in der diese Dinge gezeigt oder verwendet werden. Erst der künstlerische Akt selbst macht die Zange, umfunktioniert zur Vase, vom Bildungssubjekt potenziell in ihrem Verhältnis zum Selbst, zu Anderen und zur Welt erkennbar. Dieser, wie auch der Akt des Reisens, verändert nämlich nicht in erster Linie die Funktion des Dings, sondern vor allem den Deutungsrahmen, in dem dieses erkannt werden kann. Es ist also die bewusste Kontextverschiebung, die eine Transformation vom Ding zum Objekt in einem bildungstheoretisch relevanten Sinn erreichen kann. Dies gilt sowohl für die Künstler*innen selbst, als auch für die Rezipient*innen von Kunst. Alltagsdinge müssen also aus dem Alltagssetting befreit werden, so eine erneute Zwischenconclusio, um für das Subjekt sichtbar werden zu können.
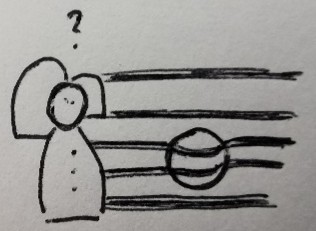
Abb. 4
Vom hybriden Ding zum Objekt – Begriffsbestimmung und Transformation
„Es ist Zeit deinen ersten Space zu erstellen!“ Mit dieser oder anderen freundlichen und direkt adressierten Aufforderungen werden Nutzer*innen der App Blinkist<[6] jeden Tag auf ihrem Smartphone konfrontiert. Blinkist greift dabei auf einen Bot[7] zurück, der auf menschliche Art und Weise einseitig mit Personen kommunizieren kann. Bei Bots, KIs etc. blicken wir auf eine andere Kategorie von Dingen, nämlich jene der sogenannten Hybride. Mit dieser spezifischen Form von Dingen lässt sich eindrücklich zeigen, wie Funktionalität und subjektive/ gesellschaftliche Transformation zusammenhängen. Mit dem Blick auf Hybride zeigt sich auch, welche Form der Kontextverschiebung es bei Alltagsdingen braucht, um diese bildungstheoretisch relevant zu machen.
Hybride sind Dinge, die sich nicht länger eindeutig der materiell-technischen Dingwelt im vorgestellten Heidegger’schen Sinne zuordnen lassen. Genscheren oder Künstliche Intelligenzen, als Werkzeuge des Bio-Engineerings und der Künstlichen Intelligenz Forschung und Robotik, beispielsweise sind zwar einerseits technische Dinge wie Heideggers Zange, jedoch andererseits auch ganz augenscheinlich Teil anderer Bereiche, wie in diesen Fällen unter anderem auch der Neuro-und Human-Biologie. Längst sind diese auch in den Alltag migriert und bereichern die Funktion von unterschiedlichen Dingen, wie Computern, Handys, Biotest-kids etc. Roßler kategorisiert solche Dinge in seinem Artikel Kleine Galerie neuer Dingbegriffe (2016) und in Anschluss an die Überlegungen von Latours Akteur-Netzwerk-Theorie als Hybride. Diese befinden sich im Zwischen der Kategorien von (Non-)Humans und Technik/Gesellschaftlichem, das heißt dem Lebendigen und dem technisch oder gesellschaftlich Geschaffenen. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt produziert solche Hybridwesen im Kontext des Findens und Beschreibens von Naturgesetzen zwar nicht (immer) intentional, wie Roßler schreibt, jedoch dennoch am laufenden Band. (Roßler 2016: 79)
Nun kann das Lebendige, die sogenannte Natur, nie einem eindeutigen Zweck zugeordnet werden. Natürliche Dinge sind – so könnte man in Anschluss an Roßler sagen – immer auch schon Objekte und zwar trotz aufrechter Funktionalität. Genscheren und Künstliche Intelligenzen weisen demnach nicht nur Dingcharakter auf, diese sind in dem Sinne auch Objekte, weil sie wie der Leib des Subjekts Teil des Lebendigen sind (Genschere als biologisches und somit lebendiges Konstrukt; Künstliche Intelligenz als dem Menschen nachempfundene Intelligenz). Das heißt, Hybride können sich im Gegensatz zu anderen Dingen des Alltags dem potenziellen Bildungssubjekt sowohl als Ding als auch als Objekt zeigen, nämlich dann, wenn die Lebendigkeit dieser ins Blickfeld des Subjekts gerät. KIs und Bots sprechen mit uns, als wäre da ein tatsächliches Gegenüber[8]. Die teilweise Beziehung zum Menschlichen macht das Hybrid für das Bildungssubjekt mannigfaltig(er) deutbar. Hybride sind zwar (meist) für einen bestimmten Zweck produziert worden bzw. stammen aus einem eindeutigen Zusammenhang ihrer Entstehung, diese gehen jedoch durch ihren Zwischenstatus über diese Funktionalität immer schon hinaus. Konkret zeigt sich das in ihrer Anwendung: Wie sich Künstliche Intelligenzen und Genscheren gegenüber unterschiedlichen Anwendungen ‚verhalten‘, zeigt sich beispielsweise erst in ebenjenen Anwendungen. Die angelegte ‚Lebendigkeit‘ ermöglicht Hybriden zudem spontane Transformationen[9]. Von ihren Nutzer*innen werden diese deshalb in vielen unterschiedlichen Kontexten des Alltags verwendet. Dabei kommt es sowohl zur Transformation des subjektiven und gesellschaftlichen Lebens als auch zur Transformation der Hybride selbst. Bei Hybriden scheint somit die herausgearbeitete bildungstheoretisch relevante Voraussetzung erfüllt: Sie zeigen sich den Subjekten nicht nur als schwaches Objekt, sie vermögen es durch ihre breite Deutbarkeit die Kontexte zu verschieben, in denen diese angewandt werden. Ihnen Bildungspotenzial per se abzusprechen, wird somit befragbar. (Vgl. Zobl 2023)
Dinge des Alltags haben als Hybride eine neue Komplexität im Verhältnis zum Subjekt erreicht. Das Hybrid ist beides, sowohl lebendig als auch dinghaft. Hybride gehen durch ihre Zwischenposition über ihre eindeutige Funktionalität im Heidegger‘schen Sinne hinaus, können also in gewisser Hinsicht wie Dinge im Kontext des Reisens oder der Kunst für das Subjekt als sichtbar und bedeutungsoffen gelten. Dies zeigt sich an der ‚lauten‘ öffentlichen Diskussion und ihren Einsatzgebieten, die von den Anwender*innen selbst in einem starken Sinne mitbestimmt und vorgegeben werden. Die Verwendung von Chat-GPT zum Schreiben von Hausarbeiten in Schule und Studium vermochte es beispielsweise in sehr kurzen Zeiträumen institutionelle Rahmenbedingungen zu befragen und zu verändern[10]. Die Kontexte des Einsatzes von Hybriden verändern sich laufend und schnell. Konkret heißt das, dass die Art und Weise, wie wir unser Alltagsleben leben, sich durch die Dinge verändert. Es stellt sich jedoch auch hier die Frage, ob diese Transformationen bzw. die erwirkten Kontextverschiebung im Alltag von Subjekten Bildungsprozesse ermöglichen können?
Es scheint wichtig, sich jene durch Hybride erwirkten Kontextverschiebungen genauer anzusehen. Was unterscheidet den Einsatz von Hybriden in unterschiedlichen alltäglichen Kontexten, wie etwa beim Schreiben von Hausarbeiten und beim Einholen juristischer Hilfe vom oben angeführten Beispiel des Einsatzes von Scheren in der koreanischen Küche? Denn, um dies gleich vorwegzunehmen: Wie auch bei ‚einfachen‘ Alltagsdingen steht hier die Funktionalität der Hybride im Vordergrund und damit dem Subjekt bildungstheoretisch im Weg. Werden Hybride zwar durch ihre mannigfaltige Deutbarkeit in immer anderen alltäglichen Kontexten verwendet, so bleibt der Fokus dabei auf dem vorgesehen Zweck dieser. Das heißt, das alltägliche Leben wird zwar vom Subjekt unter veränderten technologischen Voraussetzungen bewältigt, grundsätzlich bleibt das strukturelle Leben des Subjekts aber wiedererkennbar. Kann das Subjekt gegenwärtig beispielsweise selbst einkaufen gehen, sich seine Lebensmittel im Abo System oder nach Online-Bestellung liefern lassen oder seinen ‚smarten‘ Kühlschrank damit beauftragen, am Prozess und der Alltagslogik der Lebensmittelbeschaffung im Supermarkt wurde durch diese Optionen nicht gerüttelt. Das Subjekt hat aber nun die Möglichkeit oder auch den gesellschaftlichen Druck, sich im Kontext der Lebensmittelbeschaffung durch die neuen zweckmäßigeren Dinge zu optimieren. (Vgl. Hof 2018; Langemeyer 2021) Selbst wenn im Extremfall von Subjekten ‚Freundschaften‘ zu Hybriden eingegangen werden, so wird durch den Hybrid das Bedürfnis des Gemeinsam-Seins bzw. der Kommunikation befriedet. Das Subjekt erwartet bzw. kann nicht vom Hybrid erwarten, dass sich dieses als widerständig in einem für das Subjekt ‚unbequemen‘ Sinn erweist, auch wenn gerade dies letztlich bildungstheoretisch relevant wäre[11]. Freundschaften werden durch Hybride ‚optimiert‘, d.h. weniger anstrengend auf Beziehungsebene. Subjekte wollen auch bei Hybriden Funktionen erfüllt wissen. Die unterschiedlichen Einsatzgebiete der Dinge bieten ihm keine oder nur geringe Möglichkeiten des Erkennens der grundlegenden Veränderbarkeit von Kontexten und Dingen, d.h. deren Objektivierung im starken Sinne. Es braucht also noch andere Kontexte, in denen sich jene Dinge als bildungstheoretisch starke Objekte zeigen.
Um zum Wording von Heidegger zurückzukehren, sind Hybride für das potenzielle Bildungssubjekt halbtransparent, sie zeigen sich diesem nur teilweise, da sie sich als Dinge in der materiellen Welt ‚unsichtbar‘ einschreiben und nur teilweise als Objekte sichtbar sind. In den öffentlichen Debatten, die es im Gegensatz zu den ‚einfachen‘ Alltagsdingen gibt, werden Hybride wahrscheinlich gerade deshalb intensiv verhandelt. Es sind äußerst kontroverse Debatten, die von einer starken Emotionalität gegenüber diesen Dingen getragen sind. Hybride werden zwar viel und gerne in vielen Zusammenhängen benutzt, Subjekte haben aber auch Angst vor dem ‚Aufstand‘ bzw. ‚Erwachen‘ und damit vor dem tatsächlichen Lebendig-Werden jener hybriden Alltagsdinge. (Vgl. u.a. Buchmann 2023; Pause Giant AI Experiments 2023). Die Deutungsoffenheit der Funktionalität von Hybriden wird dementsprechend nicht als potenzieller Ausgang von Kritik bzw. Bildungsprozessen gefasst, sondern es kommt im Gegenteil zur Überbetonung der direkten oder indirekten Gefährdung von Mensch und Gesellschaft durch jene hybriden Dinge. Die Subjekte werden durch Hybride – so könnte man sagen – eher sogar resistenter gegenüber Bildungsprozessen, da es keinen Safe Space zu geben scheint.
Bildungstheoretische Auseinandersetzungen mit Dingen, wenn sie überhaupt systematisch geführt werden[12], bewegen sich auch häufig zwischen jenen Extremen[13]. Alltagsdingen und im Speziellen Hybriden werden ebenjene manipulativen Kräfte adjustiert, die das Subjekt in seiner Freiheit einzurschränken vermögen. Dies zeigt sich auch daran, dass Hybriden im deutschsprachigen Raum Bildungspotenzial nicht explizit zugesprochen wird, auch wenn ihre Rolle für Selbst, Andere und Welt im Kontext von Digitalisierungs-und Technologisierungsdiskursen sowie Diskursen zu Posthumanen Tendenzen verhandelt werden. (Vgl. u.a. Schenk & Karcher 2018; Buck & Zulaica y Mugica 2023) Um bildungstheoretisch relevant zu werden, müssen Hybride also nun so erschlossen werden, dass diese für das Subjekt als Objekt und dies in einem starken Sinne vorliegen. Wird Bildung als ergebnisoffener Prozess verstanden, der nicht angeleitet werden kann, so zeigt sich Kritik demgegenüber als zielgerichteter Prozess, der das Subjekt im kritischen Akt zu einer differenzierten Haltung gegenüber Diskursen, Dingen, Verhältnissen etc. bringen soll. Kritik als Prozess soll also nun wie der künstlerische Prozess oder jener des Reisens, eine Kontextverschiebung von Alltagsdingen erreichen, die eine Relationalisierung von Alltagsding und Subjekt ermöglichen. Wie kann dies gelingen?
Kritik an Dingen als potenzielle Voraussetzung von Bildungsprozessen
Damit (hybride) Alltagsdinge für das Subjekt bildungstheoretisch relevant werden können, braucht es einen Prozess, der wie das Reisen und die Kunst eine Kontextverschiebung erwirkt, in dem sich die Dinge dem Subjekt so anders zeigen können, dass ihr Zweck selbst befragbar wird. Mit Anlehnung an Foucault soll deshalb nun zuletzt Kritik gegenüber Dingen in Stellung gebracht werden, um gerade jenes für das Subjekt leisten zu können. Eine solche Kritik soll angeleitet werden können, als auch vom Subjekt selbst vollzogen werden können. Die Auseinandersetzung mit Alltagsdingen braucht im Falle einfacher Dinge ein aktives und im Fall von Hybriden ein mutiges Vorgehen, um starke Emotionalitäten zu verhindern. Wie ein solches kritisches Vorgehen aussehen kann, soll nun auf zwei unterschiedlichen Ebenen verhandelt werden. Einerseits soll der Frage nachgegangen werden, wie Hybride und einfache Dinge anders kontextualisiert werden können und zwar zunächst auf intellektueller bzw. rein sprachlichen Ebene. Andererseits soll einer kritischen Praxis nachgegangen werden, die vom Umgang mit den Alltagsdingen aus gedacht werden kann.
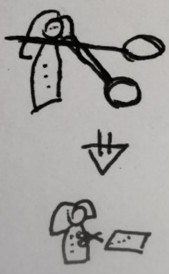
Abb. 5
Hybride Alltagsdinge kritisieren lehren und lernen
Die Kontextverschiebungen des Einsatzes von Hybriden innerhalb des Alltags reichen nicht aus, um das Hybrid für das Subjekt in eine bildungstheoretisch relevante Relation zu setzen. Bei Hybriden hilft jedoch deren öffentliche und emotionale Diskursivierung, um andere relevante Kontexte zu erschaffen. Die Angst und die Hoffnung, die gegenüber hybriden Alltagsdingen zum Ausdruck gebracht werden, werden seit vielen Jahren in Filmen, Serien, Computerspielen und Büchern aufgearbeitet. Die Alltagskontexte weichen fiktionalen Kontexten. Das Hybrid zeigt sich hier vor einem für das Subjekt anderen Hintergrund. Da popkulturelle Medien durch ihre Gefälligkeit nicht bildungsrelevant sind (vgl. Adorno 2006), braucht es einen kritischen Akt, der jene andere Kontextualisierung der Dinge für das Subjekt aufgreifen lässt.
Einen wichtigen Hinweis für das Wie eines solchen kritischen Vorgehens liefert Bakewell (2016). Sie arbeitet heraus, dass Alltagsdinge und gegenwärtig insbesondere Hybride häufig in fiktionalen Erzählungen für Stellvertreter*innendebatten verwendet werden. Es kommt bei der Darstellung von Hybriden in popkulturellen Medien zu einer Überlagerung mit anderen gesellschaftlichen Themenstellungen. Obwohl also vermeintlich Hybride in fiktionalen Erzählungen verhandelt werden, agieren diese nur als Stellvertreter für andere Themen, Verhältnisse, Phänomene etc. Dies deckt sich mit der Unsichtbarkeits-These von Alltagsdingen, die in Anschluss an Heidegger herausgearbeitet wurde: Das Hybrid an sich bleibt auch in der Erzählung über dieses eigentlich unsichtbar. Aufgegriffen und verwendet wird aber die starke Emotionalität, die mit diesen Dingen einhergeht. Obwohl eine solche Form der doppelten Kontextverschiebung intuitiv kontraproduktiv für das Vorhaben der Kritik an jenen Dingen scheint, bietet sie dennoch Potenzial für die Etablierung einer Kritik an hybriden Dingen. Es gilt daher einen genaueren Blick darauf zu werfen, was dennoch über Hybride gesagt werden kann und wie gerade das gelingt.
Die starke Emotionalität gegenüber Hybriden, die gerade deshalb gerne von Filmemacher*innen und anderen Kulturschaffenden aufgegriffen wird, lässt zunächst auf die Form der Beziehung zwischen Subjekt und Hybrid schließen. Bakewell zeigt auf, dass Subjekt und Hybrid in vielen Erzählungen in einem starken Machtgefälle zu Gunsten des Hybrids stehen. Denn es ist die Figur des schwachen Subjekts, die erfolgreiche Erzählungen ausmachen. Den Dingen kommt hierbei eine übermächtige Position zu und den Subjekten eben eine unterdrückte. (Vgl. ebd.: o.S.) Eine Kritik muss also zunächst die Funktion einer Verhältnisbestimmung zwischen Subjekt und Hybrid übernehmen, bevor eine differenzierte Auseinandersetzung ‚auf Augenhöhe‘ passieren kann. Anhand eines Beispiels soll ein solcher Weg der Kritik an Hybriden vorgezeichnet werden können, bevor dieser expliziert wird.
Die Verquickung von Hybriden mit ihrer Verwendung für gesellschaftliche (Brennpunkt)Themen zeigt sich laut Bakewell im 2014 erschienene Science-Fiction-Thriller Ex Machina[14]. Obwohl Bakewell auch auf zahlreiche Romane zurückgreifen könnte, wählt sie wahrscheinlich bewusst eine visualisierte Form der Erzählung über Hybride. Bilder bzw. Visualisierungen greifen notwendig auf gewisse Stereotype zurück, um von der Community erkannt und somit lesbar zu werden (Hemmerich 2019: 4-5), und bieten damit noch eine weitere Ebene der Analyse gegenüber schriftlichen Formen der Fiktion. Wie Alltagsdinge dargestellt werden und wie sie sich im Setting ‚verhalten‘, kann als höchst aufschlussreich angesehen werden. Zunächst schaut Bakewell auf das, was (eigentlich) erzählt wird, also auf die Erzählung abseits der gewählten Stilmittel. Ex Machina setzt sich nämlich auf den zweiten Blick nur peripher mit dem Thema der künstlichen Intelligenz und ihren Potenzialen und Gefahren unter gegenwärtigen gesellschaftlichen Voraussetzungen auseinander. Eine solche Erzählung würde sich nah am Ding bewegen, den tatsächlichen und möglichen Erscheinungsformen von KI und an den sich mit den dadurch veränderten persönlichen und gesellschaftlichen Praktiken reflektiert auseinandersetzen. Vielmehr kommt es in Ex Machina zu einer Stellvertreter*innendebatte, die nach Bakewell die Angst männlicher Stereotype vor weiblicher Emanzipation aufgreift. Bakewells Analyse ist bestechend, fokussiert man weniger auf den offensichtlichen Inhalt (künstliches Erschaffen von Menschlichkeit, Turing-Test, Datenmissbrauch etc.[15]) als vielmehr auf die Form der Erzählung: Zwei Männer dominieren eine Frau, indem sie ihren Status aktiv aus zwei unterschiedlichen Perspektiven in Frage stellen. Eine KI übernimmt dabei die Rolle der Frau. Was kann nun im Anschluss an das Ansinnen dieses Kapitels, nämlich eine Form der Kritik gegenüber Hybriden zu finden, daraus gezogen werden?
Die Debatte rund um die KI in Ex Machina überlagert und verstärkt eine noch nicht aufgearbeitete gesellschaftliche Problematik. Lässt sich nun aus der Debatte heraus aber dennoch etwas über KI oder über den aktiven, mutigen Umgang mit Hybriden sagen? Ja! Aber dafür müssen zunächst die Kontextualisierung(en) mit der(n) Funktionalität(en) des Dings zusammengeführt werden. Diese Einsicht ist für die Frage nach einer Kritik an Dingen wichtig. Nur so ist eine kritische Reflexion von Dingen und den gesellschaftlichen Verhältnissen, die diese (mit-)verursachen, möglich. Im Falle von KI und der Erzählung von Ex Machina könnte eine Analyse so aussehen: Ist die Frau dem Mann ebenbürtig, so scheint auch die KI den Männern (und Frauen) in gewisser Weise ebenbürtig zu sein. Betrachtet man ihre Funktion, so rührt sie an die menschliche Fähigkeit zum logisch-mathematischen Denken und übertrifft die menschliche Fähigkeit in manchen Bereichen bereits jetzt[16]. Der Mensch wird durch die KI ersetzbar. Traut man der Erzählung um Ex Machina, dann wird diese Veränderung für den Menschen radikal und nicht zu seinem Besten ausfallen: Menschen und im Speziellen Männer braucht es als Teil der Gesellschaft nicht länger.
Begegnet man der Erzählung nach der (sehr verkürzten) Analyse nun aus der neuen Perspektive, so zeigt sich ein relativiertes Bild: So wenig die Frauen die Männer nach der gesellschaftlichen Gleichstellung vollständig ersetzen werden, so unwahrscheinlich ist es, dass KI den Menschen vollständig ersetzen wird. Dem Machtkampf zwischen den (vielen) Geschlechtern wird noch ein neuer Player hinzugefügt, nämlich die KI. Das Bild des Mannes und auch jenes der Frau, so zeigt sich anhand der Debatte rund um KI, wird zu einseitig gezeichnet. Das Bild von KI, so der Rückschluss, wird dagegen überschätzt. Das logisch-mathematische Denken und Handeln und die gigantischen Rechenkapazitäten, Fähigkeiten, die nach stereotyper Betrachtung eher Männern zugeschrieben werden, verlieren (weiter) an Relevanz. Explizit wird dies an den neuen Programmiersprachen rund um ChatGPT etc., die keine logischen, sondern literarische sind[17]. Frauen als auch KI bedrohen also die männliche bzw. menschliche Vormachtstellung vor allem in Bezug auf jene Fähigkeit des logisch-mathematischen Denkens und Handelns. (Männliche) Menschen werden sich im Kontext von KI neu definieren und gesellschaftlich neu einbetten müssen.
Bereits diese schemenhaften Überlegungen zur Funktion von KI machen diese als hybrides Alltagsding (an sich) und ihre gesellschaftliche Einbettung bzw. Einbettbarkeit kritisch reflektierbar. Es braucht den Zusammenschluss von funktionalem Ding, gesellschaftlichem Kontext – der sich aus der Erzählung ergibt – und fiktionalem Diskurs, um eine aktive und mutige Haltung von Subjekten gegenüber Hybriden und somit Kritik an Dinge zu ermöglichen. Eine solche Praxis der Kritik, die anleitbar ist, kann als potenzieller Ausgang von Bildungsprozessen verstanden werden.
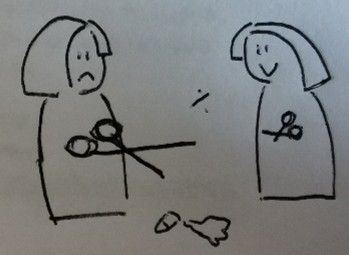
Abb. 6
Einfache Alltagsdinge kritisieren lehren und lernen
Die bisherige Darstellung zeigte, dass Kritik an Hybriden über die Verhältnissetzung ihrer Funktionalität zu den sie umgebenden fiktionalen Erzählungen und ihrer gesellschaftlichen Einbettung erreicht werden kann. Der Begriff der Funktionalität erweitert sich damit über den Zweck des Alltagsdings hinaus zu einer Funktionalität, die die subjektive und gesellschaftliche Rahmung mitmeint. Denn, wie ich mit Hilfe von Bakewell zeigen konnte, sind es gerade Scheindebatten, die Dysfunktionalitäten von Dingen gegenüber einer spezifischen gesellschaftlichen Gruppe offenlegen können. Im Falle der KI zeigte sich, dass diese den Menschen nicht nur unterstützen (Funktion), sondern in gewisser Weise ersetzen und das Menschliche somit befragbar machen (Dysfunktion). Was aber, wenn es solche (Schein-)Debatten rund um bestimmte Dinge (vermeintlich) nicht gibt oder eine Recherche aus bestimmten Gründen nicht möglich ist? Um der Frage nach einer Praxis der Kritik an den einfachen Dingen des Alltags nachzugehen, stellt sich zunächst und in Anschluss an das vorangegangene Kapitel die Frage nach dem Vorhandensein von Erzählungen rund um banalere Dinge, wie etwa Werkzeuge, mit denen auch Schüler*innen eher umgehen als mit Hybriden. Erschließt sich die Überlegung zur Verschränkung von Gesellschaft und Ding beim Nachdenken über KI womöglich einfach, da die Debatten recht ‚laut‘, d.h. emotionsgeladen und breitenwirksam geführt werden, so ist dies bei der Auseinandersetzung mit einfachen Werkzeugen weniger augenscheinlich. Doch auch hier gibt es Erzählungen, die sich aufgreifen lassen. Leider sind diese oft dermaßen in das gesellschaftliche Leben eingewoben, dass sie nur schwer als solche zu entlarven sind. Sie zeigen sich im Verhältnis zu den Erzählungen rund um Hybride aber auch weniger abstrakt und meist eingelassen in den Alltag. Am Beispiel von einfachen Handwerkzeugen kann dies gezeigt werden: Das vermeintliche Ungeschick von Frauen und Kindern beim Werkzeuggebrauch kann beispielsweise als Erzählung verstanden werden. Diese kann nämlich darauf zurückgeführt werden, dass gängige Werkzeuge schlicht nicht für die durchschnittliche Größe von Frauen- oder auch Kinderhände gemacht sind (Criado-Perez 2020: 170-178). Die ‚Kunst‘ des kritischen Aktes ist es, solche Erzählungen, wie jene über das Ungeschick von Frauen beim Werkzeuggebrauch, allererst als (fiktionale) Erzählungen zu erkennen. Die spezifische Diskursivierung jener Werkzeuge verweist auf ihre Dysfunktionalität für Frauen und Kinder, die ein kritisches Aufgreifen der Funktionalität des spezifischen Dings über die Erzählung ermöglicht. Wie müssen Greifzangen für kleine Kinderhände designt sein?
Im Unterricht zeigt sich das ‚Ungeschick‘ von Mädchen wahrscheinlich ebenso. Das heißt, es kann also über den Gebrauch von Werkzeugen durch Menschen mit unterschiedlichen Handgrößen jener Diskurs abgeleitet werden, der eben zu einseitig und zu Gunsten einer spezifischen Gruppe geführt wird. Werden in einer Schulwerkstatt Werkzeuge für (männliche) Erwachsene verwendet, so korreliert das Ausmaß des vermeintlichen Ungeschicks der jungen Anwender*innen mit der Größe ihrer Hände. Schüler*innen erfahren beim Gebrauch von Werkzeugen eine solche Dysfunktionalität, ohne dass diese über Erzählungen hergeleitet werden müsste. Einfache Dinge werden so über ihren Gebrauch kritisierbar und können durch die damit erreichte Bedeutungsoffenheit potenziell Bildungsprozesse auslösen. Ein Ansatz, der gerade im Technik und Design Unterricht, der das Handeln in den Mittelpunkt stellt[18], interessant ist. Doch wie kann ein solcher kritischer Prozess konkret angeleitet werden?
Es sollen in diesem letzten Teil die spezifischen Voraussetzungen von Unterricht mitgedacht werden, der mitunter – wie etwa im Technik und Design Unterricht – den konkreten kritischen Umgang mit Dingen verlangt. Denn wenn Kritik wie Bildungsprozesse als für das Subjekt unhintergehbar verstanden wird, dann sollte ebenjene Kritik den Schüler*innen nicht aus einem abstrakten Diskurs über die Dinge – versprachlicht und vermittelt durch die Lehrperson – nähergebracht werden, sondern eben vielmehr aus dem Umgang mit den Dingen selbst. Nur so ist es möglich, dass Schüler*innen Kritik und Bildungsprozesse selbst üben bzw. erfahren können.
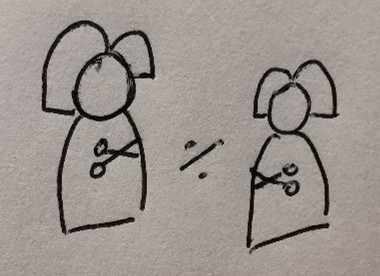
Abb. 7
Einen interessanten Anstoß zur Praxis der Kritik an Alltagsdingen im Kontext von Bildung und Schule kann Foucault mit seinen Überlegungen zur Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen durch die antike Gemeinschaft der sogenannten Kyniker*innen geben. Auch wenn jene Kritik der Kyniker*innen von Foucault als affirmative, nicht-distanzierte oder gar versprachlichte Praxis verstanden wird (Sonderegger 2016), lässt sich die Praxis der Kyniker*innen dennoch im Kontext der Fragestellung diese Artikels aufgreifen, nämlich wenn es um die Frage nach einem angemessenen Ins-Verhältnis-Setzen anhand des konkreten Umgangs mit Dingen geht. Denn die Kyniker*innen griffen für eine Kritik an und durch Dinge eben nicht auf Erzählungen über Dinge zurück, sondern dekonstruierten gemeinschaftlich die durch die Dinge vermittelten Praktiken.
Foucault setzt sich in vielen seiner Überlegungen auch indirekt mit dem Verhältnis der Subjekte bzw. der Gesellschaft mit Alltagsdingen auseinander, nämlich dann, wenn er über die Macht von Institutionen nachdenkt. Konkret geht es ihm um den Nachweis, dass durch die Anwesenheit von Institutionen (Dingen) spezifische individuelle und gesellschaftliche Praktiken unterstützt, erschwert oder auch verhindert werden. Explizit wird dies anhand seiner Auseinandersetzung mit der Praxis des Strafens und den institutionellen Entsprechungen von Gefängnissen, deren Bauart und herrschaftlicher Zweck korrelieren[19]. Er kommt dabei nicht umhin, zwischen Konstruktionsweise (Design von Dingen) und der Manifestation von Macht und Herrschaft durch und mittels dieser institutionell materialisierten Gebäude (gesellschaftliche Einbettung von Dingen) zu unterscheiden. Die enge Verwobenheit von Dingen und individuellem und gesellschaftlichem Leben, das sich anhand von spezifischen Praktiken zeigt, gehen in seiner Theorie der Gouvermentalität auf, die es ihm ermöglicht, problematische Praktiken zu erkennen, zu benennen, zu beschreiben und schließlich zu kritisieren. (Vgl. Sonderegger 2016) Eine wichtige Einsicht Foucaults in diesem Zusammenhang ist, dass die Regierung des Selbst durch den*die*das Andere nur durch das „Mitwirken sich selbst führender Subjekte“ (ebd.: 50) gelingen kann. Den Dingen könnte nun eine übermäßige Macht gegenüber den Subjekten zugesprochen werden, denn diese sind es, die gewissen von den Herrschenden präferierte Praktiken so unterstützen, dass es die Subjekte nicht einmal bemerken (Unsichtbarkeit der Dinge). Doch Foucault sieht gerade hier eine Möglichkeit für die beherrschten Subjekte, denn die Vormachtstellung der Herrschenden gegenüber den Beherrschten wird so überraschenderweise gerade über den Einbezug der Dinge durchbrechbar. Das Ding, so möchte ich Foucault verstehen, ist ein machtvolles ‚Werkzeug‘ aller Subjekte, das es ermöglicht, sich oder Andere gesellschaftlich (anders) einzubetten.
Foucault versucht in Anschluss an seine Gouvermentalitätstheorie eine Praxis der Kritik zu finden, die es den beherrschten Subjekten ermöglicht, sich nicht „dermaßen regieren zu lassen“ (Foucault 1992: 12). Ich nehme diesen Gedanken auf und frage, wie es möglich ist, sich von den Dingen nicht „dermaßen“ manipulieren zu lassen. Der Begriff der Kritik bekommt an dieser Stelle einen affirmativen Anstrich, denn es geht Foucault nicht darum Herrschaft (bzw. Dinge) per se abzulehnen, sondern sich die vermittelte Macht gegenüber dem Selbst und der Gesellschaft reflexiv bewusst zu machen, um Kritik üben zu können. Doch wie gelingt es Foucault nun konkret und dies anhand der Praktiken der Kyniker*innen eine solche affirmative Praxis von Kritik zu denken?
Wesentlich für eine Praxis der Kritik sind für die Kyniker*innen fünf Schritte: Erstens braucht es eine gemeinsam agierende Gruppe, die zweitens heterogen zusammengesetzt ist. Drittens braucht es eine gemeinsame Reflexion von Praktiken, die dann viertens auf leiblicher Ebene nachvollzogen werden, um fünftens das gesellschaftliche Leben kritisieren und im besten Fall transformieren zu können.
- Erstens bis drittens: Einzelpersonen scheint es kaum oder nur sehr begrenzt möglich zu sein, Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen zu So sind die Kyniker*innen eine heterogene Gruppe von Bürger*innen aller Schichten, die bewusst auch Sklaven*innen umfassten. (Sonderegger 2016: 60) Die Kyniker*innen nutzen in der heterogenen Gruppe den Blick des*der Anderen, um problematische Praktiken erkennen zu können. Dies kann vor allem deshalb gelingen, da sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten durch die unterschiedliche Zahl und Art der Dinge auch unterschiedliche Praktiken manifestieren. Der befremdete Blick des anderen Subjekts in der Gemeinschaft auf das für ihn Neue, ermöglicht ein Erkennen, das zur Reflexivwerdung dieser (eigenen) machtvollen Praktik führen kann.
- Viertens: Wurde eine bestimmte Praktik erkannt und für das praktizierende Individuum – als Teil einer spezifischen Gesellschaftsschicht – als problematisch beurteilt, braucht es den leiblichen Nachvollzug dieser Praktik. Die bewusste Rekonstruktion der einzelnen Denk- und Handlungsweisen, die jene Praktik umfasst, führt die Gruppe unvermeidlich mitunter zu den involvierten (technisch hergestellten) Dingen und ihrer Rolle darin. Erst jetzt ist es den Kyniker*innen möglich, Kritik durch das bewusste, aber auch experimentelle Eingreifen innerhalb dieser Praktiken zu üben.
- Fünftens: Kritik wird von den Kyniker*innen sowohl auf sprachlicher als auch auf leiblicher Ebene vollzogen. Wie Sonderegger herausarbeitet, kann es sich einerseits um eine schiere Verweigerung der problematischen Praktiken handeln, aber anderseits auch um eine experimentelle Umdeutung von Praktiken (Verschiebung, Störung), die eine Veränderung dieser und somit auch des individuellen und gesellschaftlichen Lebens nach sich ziehen (Sonderegger 2016: 69) Interessant an einer solchen Form von Kritik ist, dass die Auswirkungen auf die Praktiken bzw. auf das Leben nicht vollständig absehbar sind. Den Kyniker*innen ging es mit ihrer Kritik um ein Sichtbar-Machen von veränderbaren Umständen. Es gelang ihnen vor allem jene Praktiken aufzuzeigen, die „am unveränderbarsten und kritikfernsten“ (Sonderegger 2016: 64-65) galten.
Auf die Schule und den Unterricht umgemünzt und hier konkret auf den Technik und Design-Unterricht, müsste zur Schaffung von Kritikfähigkeit an und durch technisch hergestellte Dinge nicht von Praktiken, sondern von Dingen als Bedingung von spezifischen Praktiken ausgegangen werden. Wie bei den Kyniker*innen könnte eine solche Praxis der Kritik an und durch Dinge in fünf Schritten ermöglicht werden.
- Erstens bis zweitens: Es braucht eine heterogene Gemeinschaft. Schulischer Unterricht setzt eine Gemeinschaft voraus. Im Gegensatz zu den Anforderungen der Kyniker*innen kann die schulische Gemeinschaft zunächst als eher homogen beschrieben So ist vor allem das Alter der Kinder in Schulklassen gleich. Auch die sozialen Herkünfte sind in vielen Schulen recht homogen verteilt. Heterogenität findet man in Schulklassen in einem weniger ausgeprägten Rahmen. Es gibt Unterschiede in der Körpergröße und -fülle, beim Geschlecht, bei den motorischen und kognitiven Fähigkeiten, bei der kulturellen Herkunft, beim Erscheinungsbild, bei der Sprachlichkeit etc. Es erscheint daher sinnvoll, auch die Lehrperson als Teil dieser Gemeinschaft zu verstehen. Im Umgang mit Dingen und vor dem Hintergrund eines fachlichen Leistungsnachweises ist jedoch gerade diese Heterogenität Grund für Anerkennungs- und Ablehnungsmechanismen: Du bist ‚gut‘ und du nicht. Die Gemeinschaft von Klasse muss also als solche verstanden und nicht als Gruppe aus lauter Individuen.
- Drittens: Es braucht den befremdenden Blick des*der Anderen. Können Dinge, die in den Kontext von Kunst eingeschrieben sind, durch ihre Bedeutungsoffenheit ermöglichen, das Individuum dermaßen zu befremden, dass Bildungsprozesse angeregt werden, so ist dies bei technisch hergestellten Dingen nicht oder nur in eingeschränktem Rahmen (Hybride) möglich. Technisch hergestellte Dinge sind funktional und somit nicht bedeutungsoffen. Da Dinge jedoch notwendig für eine spezifische Anwender*innengruppe produziert wurden, funktionieren diese für die Anderen nicht oder nur eingeschränkt. Da die Funktionalität der Dinge vermeintlich sichergestellt ist, wird die Dysfunktionalität dieser für spezifische Anwender*innen eher auf letztere projiziert. Leistungsunterschiede zwischen Schüler*innen im Fach Technik und Design werden beispielsweise eher nicht an dysfunktionale Werkzeuge rückgebunden. Um jene Dysfunktionalitäten jedoch feststellen zu können, braucht es den vergleichenden Blick des*r Diese Verschiebung im Blick der Gemeinschaft auf die technisch hergestellten Dinge eröffnet wiederum einen Raum, der Kritik am Ding letztlich ermöglicht.
- Viertens: Körperlicher Nachvollzug der Anwendung von Dingen. Um technisch hergestellte Dinge kritisieren zu können, braucht es den feinteiligen körperlichen Nachvollzug in der Anwendung und dies von jenen Anwender*innen, für die sich das Ding dysfunktional zeigt. Ist ein Handy beispielsweise für eine Hand zu groß, kann sich dies anhand unterschiedlicher Nutzungszusammenhänge Wie verhält sich das Ding bei unterschiedlichem Gebrauch? Wo zeigt es sich funktional, wo dysfunktional?
- Fünftens: Erst nach diesen vier Schritten ist es Bildungssubjekten möglich, Kritik am Ding zu üben. Im Falle von schulischem Unterricht und im Kontext von Bildung sollte diese verbalisiert werden. Die Sprache bringt Distanz zwischen das Ding und das Kritik an Dingen ist damit kein affirmativer Akt, obwohl sich die Praxis der Kritik am Ding selbst abarbeitet. Kritik am Ding ist eine gemeinschaftliche Praxis, die sowohl den Blick des*der Anderen braucht und das Übersetzen in eine Sprache für jene Gemeinschaft. Auf diese Weise kann Kritik am Ding schulinterne Erzählungen offenlegen und durch die Verschiebungen des Diskurses über die Dinge und letztlich auch über die Bildungssubjekte potenziell Bildungsprozesse auslösen.
Anmerkungen
[1] Dörpinghaus (2015), beispielsweise, versteht Bildung in Anschluss an Humboldt als „begriffliche Fähigkeit“ und „Distanzleistung“. Bildung ist sowohl ein sinnlicher als auch begrifflicher Prozess, sie ist die „Realisierung und Verfeinerung unserer begrifflichen Fähigkeiten in hermeneutischen Praxen der Aneignung von Welt“ (Dörpinghaus 2015: 466-467). Im Verhältnis zu diesem individualistischen Zugang gibt es jedoch auch Begriffe von Bildung, die diesen als per se soziale Klafki (1976) beispielsweise sieht Bildung als Ausgang von Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungsfähigkeit und von Solidarität gegenüber den Anderen.
[2] die interdisziplinäre, theoretische und politische Strömung des New Materialism thematisiert und untersucht etwa seit den 2000er Jahren gerade diesen starken Zusammenhang zwischen Subjekt, Dingen und Gesellschaft und verweist damit auf problematische Auslassungen in gängigen (Vgl. Sencindiver 2017)
[3] Designer*innen und auch Künstler*innen, die sich mit Alltagsdingen beschäftigen, setzen mit ihrer Form der Kritik gerade hier an, wenn sie Dinge in ästhetischer Hinsicht, also in Form, Materialität, Haptik etc. be- und verfremden. Die Ästhetik übernimmt im Design eine spezifische Funktion (vgl. Feige 2019), die auch eine kritische sein kann. Teilweise wird hier die Form und nicht der Zweck aufgegriffen, wie beispielsweise bei Erwin Wurm, der sich in seiner Kunst mit Alltagsdingen beschäftigt. Während er in seinem Frühwerk auf die Abwesenheit der Dinge verwies (Dust Sculptures), überspitzte er in seinem Spätwerk die Funktionalität der Dinge über die Form (Fat Car). (Vgl. Wurm J.) Designer*innen wie beispielsweise Maria Idicula Kurian befragen gerade die Funktionalität von Dingen. Bleibt die Form des Kunststoffbechers unangetastet, so wird durch die veränderte Materialität von diesem seine Funktionalität an seine Verwendung angepasst. Er zerfällt nach wenigen Minuten vollständig. (Vgl. Solanki 2022, 194-197)
[4] An dieser Stelle setzen Technikphilosophen*innen häufig an, um den einseitigen Blick auf Technik als schiere Prothese des Menschen zu brechen (Nordmann 2015: 29-40). Technik kann nie einem eindeutigen Zweck zugeordnet Plastisch wird dies beim Gedankenexperiment, bei dem man sich die Frage stellt, ob Aliens, die noch nie mit einer Waschmaschine und deren gesellschaftlicher Einbettung zu tun hatten, den Zweck einer Waschmaschine erkennen können. Gäbe es nur einen eindeutigen Zweck der Waschmaschine, nämlich Wäsche zu waschen, so müssten die Außerirdischen diesen herausfinden können.
[5] Käte Meyer-Drawe widmet in ihrem Buch Diskurse des Lernens (2008) ein ganzes Kapitel dem Verhältnis zwischen Dingen und Objekten. Unabhängig von ihrer Funktionalität, wie mit Heidegger aufgearbeitet wurde, zeigt Meyer-Drawe, in welcher Form Dinge in Beziehung zum Subjekt Dinge wollen „etwas“ vom Gegenüber. Es geht dabei um die Aufforderung zum Erinnern, Reinigen, etc. (Vgl. Meyer-Drawe 2008: 159-186)
[6] Bei Blinkist handelt es sich um ein Programm, das sowohl im Browser als auch auf mobilen Endgeräten genutzt werden Sachbücher werden von den Mitarbeiter*innen dabei in ca. 15-minütigen Zusammenfassungen auditiv und schriftlich aufgearbeitet und in der App zugänglich gemacht.
[7] Bot ist die Abkürzung für Roboter und steht für ein automatisch ablaufendes Programm, das je nach Eingabe des*r Nutzer*in reagieren kann. Bots greifen dabei im Regelfall nicht auf künstliche Intelligenz zurück. Ihre Programmierung gaukelt dem*r Nutzer*in jedoch das Sprechen mit einer echten Person vor. (Vgl. IT-Service.Network o.J.)
[8] Die japanische Gesellschaft ist mit dem Phänomen konfrontiert, dass Jugendliche sich eher mit generierten und lebendig agierenden Dingen beschäftigen als mit realen Freund*innen und sogar Liebespartner*innen werden durch Hybride ersetzt. (Vgl. Muschner 2020)
[9] Der Chatbot Tay von Microsoft, beispielsweise, verhielt sich nach kurzer Zeit auf der Social Media Plattform X rassistisch und gehässig gegenüber anderen Nutzer*innen. (Vgl. Graff 2016)
[10] In Österreich wird das Schreiben einer vorwissenschaftlichen Arbeit zum Erreichen der Matura (Abitur) beispielsweise wieder (Vgl. Kroisleitner 2024) Die Einbindung und Abgrenzung von KI basierten Prompt-Writing-Tools wird vielstimmig diskutiert.
[11] Bildungstheorien greifen häufig auf zwei Modelle von Relationalität zurück: einerseits auf die Anerkennungstheorie. Ausgehend des der Frankfurter Schule angehörigen Philosophen Axel Honneth wird diese Form der Interaktion zwischen Subjekten bildungstheoretisch aufgegriffen, etwa bei Künkler 2011, Ricken et 2023. Und andererseits die historisch etwas weiter zurückgehende Adressierungs-bzw. Anrufungstheorie, die ausgehend vom Strukturalisten Louis Althusserl bildungstheoretisch relevant ist. (Vgl. u.a. Janssen/ Kleiner/ Rose 2014; Vater 2019) Beiden Theorien zu eigen ist, dass sowohl Prozesse der Anerkennung als auch der Adressierung fragile sind.
[12] Seit etwas mehr als 10 Jahren kommt es auch zu punktuellen Auseinandersetzungen mit der Dingwelt aus bildungstheoretischer Perspektive, die sich jedoch immer wieder rasch verlaufen. Meyer-Drawe (2008) befragt die Rolle der Dinge für das Lernen. Nohl (2011) entwirft eine „Pädagogik der Dinge“ und nimmt dabei den „Austauschprozess“, der sich zwischen Dingen und Menschen entfalten in den Dörpinghaus und Nießeler (2012) arbeiten sich in ihrem Sammelband an der rational nicht beherrschbaren Eigenwertigkeit der Dingwelt ab. Thompson, Casale und Ricken (2017) fragen in ihrem Sammelband wie Debatten rund um „Sache(n)“ und „Sachlichkeit“ die gegenwärtigen bildungstheoretischen Diskussionen erweitern und differenzieren können.
[13] Meyer-Drawe, beispielsweise, arbeitet sich in Menschen im Spiegel ihrer Maschinen (2007) an den beiden Extrempositionen des Menschlichen und Maschinellen ab.
[14] Ein anderes Beispiel, das genetische Werkzeuge aufgreift, ist die 2007 in Neuseeland erschienene Horrorkomödie Black Sheep. Das Schaf als wichtiger Import, um die Versorgung der Einwohner*innen seit dem Jahrhundert zu sichern, wird durch die Genetik im Film zum blutrünstigen Todesbringer. Auch hier stellt sich die Frage, welche gesellschaftlichen Schieflagen nun durch genetische Werkzeuge neu erzählt werden können.
[15] Tatsächlich bleibt der Film bei den neuen Technologien vage in oberflächlichen und stereotypen Debatten verhaftet. Dass große Konzerne Gesetzeslücken auskosten bzw. Gesetze umgehen, um an wertvolle Daten von Nutzer*innen zu gelangen und mit diesen Handel zu treiben, wissen wir nicht erst seit den skandalösen Veröffentlichungen rund um und von Edward Snowden (2019). Gemeinsam mit dem amerikanischen High-Tech-Experten und nach wie vor vom amerikanischen Rechtsstaat geahndeten Whistle-Blower entwickelte die Europäische Union ein europaweit gültiges Datenschutzgesetz. (Beham/ Hübelbauer 2017)
[16] Insbesondere bei visuellen Aufgaben wie Bildanalyse und Objekterkennung und auch Sprach- und Leseverständnis übertreffen KIs den Menschen bereits jetzt. (Krichmayr 2024)
[17] Prompt-Writing beschreibt eine Art Programmiersprachen, bei denen die Anwender*innen Handlungsanweisungen für KIs schreiben. (Lobe 2023)
[18] Postkritische Überlegungen kritisieren gerade jene Distanzierungsnotwendigkeit der So wird auch im zweiten Grundsatz des Manifests für eine Postkritische-Pädagogik eine affirmative Form von Kritik gefordert (Hodgson/ Vlieghe/ Zamojski 2022: 21). Wird Bildung jedoch im klassischen, humboldtschen Sinne als ausdifferenzierten Versprachlichung von Erfahrungen verstanden (Dörpinghaus 2015), wie hier vorgeschlagen, so soll hier ebenfalls auf Sprachlichkeit als Ausgang von Kritik geachtet werden.
[19] Seine Überlegungen zu Benhams Panopticon zeigen die enge Verbindung zwischen „architektonischer Gestalt“, also dem Dinghaften von Gebäuden, und ihren machtvollen Funktionen der Disziplinierung (Foucault 2008: 905-915).
Literatur
Adorno, Theodor (2003): Adorno. Soziologische Schriften I. Frankfurt a. M: Suhrkamp. S. 93-121. Adorno, Theodor (2006): Theorie der Halbbildung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Bakewell, Sarah (2016): Das Café der Existenzialisten: Freiheit, Sein und Aprikosencocktails. Audible Höhrbuch.
Beham, Georg/ Hübelbauer, Reinhard (2017): EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Praxiseinführung in 7 Schritten. Wien: Austrian Standards plus.
Benner, Dietrich (1999): „Der Andere“ und „Das Andere“ als Problem und Aufgabe von Erziehung und Bildung. In: Zeitschrift für Pädagogik, 45, Jg., Heft 3, S. 315-328.
Benner, Dietrich (2015): Allgemeine Pädagogik. Eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur pädagogischen Denkens und Handelns. Weinheim: Beltz-Juventa.
Buchmann, Peter (2023): Künstliche Intelligenz. Angst vor KI ist weit verbreitet – was ist realistisch? Online unter: https://www.srf.ch/news/kuenstliche-intelligenz-angst-vor-ki-ist-weit-verbreitet-was-ist-realistisch [Stand 20.09.2024]
Buck, Marc. & Zulaica y Mugica, Miguel: Digitalisierte Lebenswelten. Bildungstheoretische Reflexionen. Berlin: Metzler.
Burckhardt, Lucius (2010): Design ist unsichtbar. In: Edelbach, Klaus/ Terstiege, Gerrit [Hg.]: Gestaltung denken. Grundlagentexte zu Design und Architektur. Basel: Birkhäuser, S. 211–217.
Criado-Perez, Caroline (2020): Unsichtbare Frauen. Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. München: Btb.
Dörpinghaus, Andreas/ Nießeler, Andreas (2012): Dinge in der Welt der Bildung. Bildung in der Welt der Dinge. Würzburg: Könighausen & Neumann.
Dörpinghaus, Andreas (2015): Theorie der Bildung. Versuch einer „unzureichenden“ Grundlegung. In: Zeitschrift für Pädagogik, 61. Jg., Heft 4, S. 464-480.
Euler, Peter (1999): Technologie und Urteilskraft. Zur Neufassung des Bildungsbegriffs. Deutscher Studien-Verlag. Online unter: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/3868/ [18.10.2021]
Feige, Daniel (2019): Design. Eine philosophische Analyse. Berlin: Suhrkamp. Foucault, Michel (1992): Was ist Kritik? Leipzig: Merve.
Foucault, Michel (2008): Überwachen und Strafen. In: Michel Foucault. Die Hauptwerke. Berlin: Suhrkamp. S. 701-1020.
Goethe, Johann Wolfgang von (1976): Italienische Reise. Online unter: https://archive.org/details/italienischereis0000goet_y9d8/page/n7/mode/2up [Stand 19.09.2024]
Graff, Bernd (2016): Rassistischer Chat-Roboter. Mit falschen Werten bombardiert. Online unter: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/microsoft-programm-tay-rassistischer-chat-roboter-mit-falschen-werten-bombardiert-1.2928421 [Stand 20.09.2024]
Heidegger, Martin (2006): Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer.
Hemmerich, Fabian (2019): Inwiefern sind ethnische Stereotype in Kinderfilmen ein pädagogisch relevantes Problem? Eine Auseinandersetzung anhand von drei Filmbeispielen. In: Medienimpulse, 57. Jg., Nr. 2, Online unter: https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/1949 [02.07.2024]
Hodgson, Naomi/ Vlieghe, Joris/ Zamojski, Piotr (2022): Manifest für eine Post-Kritische-Pädagogik. In: Bittner, Martin/ Wischmann, Anke (Hg.): Kritik und Post-Kritik. Zur deutschsprachigen Rezeption des „Manifests für eine Post-Kritische Pädagogik“, Bielefeld: Transkript, S. 19-26.
Hof, Barbara (2018): Der Bildungstechnologe. In: Schenk, S. & Karcher, M. (Hrsg.): Überschreitungslogiken und die Grenzen des Humanen. S. 27 – 52. Online unter: https://www.pedocs.de/volltexte/2018/16105/pdf/Schenk_Karcher_2018_Ueberschreitungslogiken.pdf [Stand 20.09.2024]
Humboldt, Wilhelm von (1903-1936): Gesammelte Schriften. Online unter: https://archive.org/details/gesammelteschrif14humbuoft/page/20/mode/2up [Stand 19.09.2024]
IT-Service.Network (o.J.): Bot – Definition. Online unter: https://it-service.network/it-lexikon/bot/ [Stand 20.09.2024]
Janssen, Angela/ Bettina Kleiner & Nadine Rose (Hrsg.) (2014): (Re-)Produktion von Ungleichheiten im Schulalltag. Judith Butlers Konzept der Subjektivation in der erziehungswissenschaftlichen Forschung. Opladen / Berlin / Toronto: Barbara Budrich.
Kant, Immanuel (2009): Kritik der Urteilskraft. Hamburg: Meiner.
Klafki, Wolfgang (1976): Aspekte kritisch-konstruktiver Erziehungswissenschaft. Weinheim: Beltz. Koller, Hans-Christoph (2010): Grundzüge einer Theorie transformatorischer Bildungsprozesse. In: Liesner, Andrea/ Lohmann, Ingrid (Hg.): Gesellschaftliche Bedingungen von Bildung und Erziehung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 288-300.
Krichmayr, Karin (2024): Künstliche Intelligenz übertrifft menschliche Fähigkeiten immer schneller. Stanford Studie. Online unter: https://www.derstandard.at/story/3000000216233/kuenstliche-intelligenz-uebertrifft-menschliche-faehigkeiten-immer-schneller [10.06.2024]
Kroisleitner, Oona (2024): Polaschek will verpflichtende vorwissenschaftliche Arbeit als Teil der Matura abschaffen. Online unter: https://www.derstandard.at/story/3000000222881/vorwissenschaftliche-arbeit-als-teil-der-matura-wird-abgeschafft [Stand 20.09.2024]
Künkler, Tobias (2011): Lernen in Beziehung. Zum Verhältnis von Subjektivität und Relationalität in Lernprozessen. Bielefeld: Transkript.
Langemeyer, Ines (2021): Optimierung von Arbeits-, Lern-und Vergesellschaftungsprozessen mittels KI – Anmerkungen aus psychologischer und pädagogischer Sicht. In: Terhart, H.; Hofhues, S. & Kleinau, (Hrsg.): Optimierung. Anschlüsse an den 27. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Opladen, Berlin & Toronto: Barbara Budrich, S. 231-248.
Liptow, Jasper (2013): Philosophie des Geistes zu Einführung. Hamburg: Junius.
Lobe, Adrian (2023): Prompt-Writing: Der gefragteste Job-Skill des Jahrhunderts? Online unter: https:// www.derstandard.at/story/2000146157314/prompt-writing-der-gefragteste-job-skill-des-jahrhunderts [10.06.2024]
Lyotard, Jean-Francois (1994): Die Analytik des Erhabenen – Kant Lektionen. Paderborn: Fink. Meyer-Drawe, Käte (2007): Menschen im Spiegel ihrer Maschinen. Paderborn: Wilhelm Fink. Meyer-Drawe, Käte (2008): Diskurse des Lernens. Paderborn: Wilhelm Fink.
Mollenhauer, Klaus (2008): Vergessene Zusammenhänge. Über Kultur und Erziehung. Weinheim: Beltz Juventa.
Montessori, Maria (2007): Kosmische Erziehung. Die Stellung des Menschen im Kosmos. Menschliche Potenzialität und Erziehung. Von der Kindheit zur Jugend. Freiburg/ München/ Berlin: Herder.
Muschner, Jens (2020): KI kann Beziehungen in Japan verändern. Online unter: https://sumikai.com/ nachrichten-aus-japan/ki-kann-beziehungen-in-japan-veraendern-271475/ [Stand 20.09.2024]
Newport, Cal (2019): Digital Minimalism. Choosing a Focuses Life in a Noisy World. Newport: Penguin Business.
Nohl, Arndt-Michael (2011): Pädagogik der Dinge. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Nordmann, Alfred (2015): Technikphilosophie zur Einführung. Hamburg: Junius.
Pause Giant AI Experiments (2023): Pause Giant AI Experiments: An Open Letter. Online unter: https:// futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/ [Stand 20.09.2024]
Ricken, Norbert et al. (2023): Die Sprachlichkeit der Anerkennung. Subjektivierungstheoretische Perspektiven auf eine Form des Pädagogischen. Weinheim: Beltz.
Roßler, Gustav (2016): Kleine Galerie neuer Dingbegriffe: Hybriden, Quasi-Objekte, Grenzobjekte, epistemische Objekte. In: Kneer, Georg/ Schroer, Markus/ Schüttpelz, Erhard [Hrsg.]: Bruno Latours Kollektive. Berlin: Suhrkamp, S. 76-107.
Rousseau, Jean Jaques (2003): Emile oder Über die Erziehung. Stuttgart: utb.
Ruprecht, Mattig (2021): Reisen für die Bildung der Menschheit. Zur ethnographischen Methode Wilhelm von Humboldts. Online unter: https://www.pedocs.de/volltexte/2022/23906/pdf/BF_2021_2_Mattig_Reisen_fuer_die_Bildung.pdf [Stand 20.09.2024]
Schenk, S. & Karcher, M. (Hrsg.): Überschreitungslogiken und die Grenzen des Humanen. Online unter: https://www.pedocs.de/volltexte/2018/16105/pdf/Schenk_Karcher_2018_Ueberschreitungslogiken.pdf [Stand 20.09.2024]
Schiller, Friedrich (1984): Über das Schöne und die Kunst. Schriften zur Ästhetik. München: dtv klassik. Snowden, Edward (2019): Permanent Record. Meine Geschichte. Frankfurt a. M.: Fischer.
Schäfer, Alfred (2020): Bildung und Negativität. Annäherung an die Philosophie Christoph Menkes. Weilerswist: Velbrück.
Schmidgen, Henning (2018): 1818 -Der Frankenstein-Komplex. In: Latour, Bruno: Aramis oder Die Liebe zur Technik. Tübingen: Mohr Siebeck, S. 303-319.
Sencindiver, Susan Yi (2017): New Materialism. Online unter: https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0016.xml [Stand 19.09.2024]
Solanki, Seetal (2022): Why Materials Matter. Responsible Design for a better World. München, London & New York: Prestel.
Sonderegger, Ruth (2016): Foucaults Kyniker_innen. Auf dem Weg zu einer kreativen und affirmativen Kritik. In: Lorey, Isabell/ Ludwig, Gundula/ Sonderegger, Ruth: Foucaults Gegenwart. Sexualität – Sorge – Revolution. transversal texts, S. 47-75; Online unter: http://transversal.at/books/foucaults-gegenwart [24.07.2023]
Thompson, Christiane/ Casale, Rita/ Ricken, Norbert (Hg.) (2017): Die Sache(n) der Bildung. München: Ferdinand Schöningh.
Vater, Stefan (2019): Neoliberale Subjektivität. Sei du! In: Beiträge zur Erwachsenenbildung (2) 1, S. 23-32.
Wurm, Erwin (o.J.): Erwin Wurm: Artworks. Online unter: https://www.erwinwurm.at/artworks.html [Stand 20.09.2024]
Zobl, Cornelia (2023): Digitale Spielräume. Fortnite (spielen) als Herausforderung und Möglichkeit bildungstheoretischer Auseinandersetzung. In: Buck, F. & Zulaica y Mugica, M: Digitalisierte Lebenswelten. Bildungstheoretische Reflexionen. Berlin: Metzler, S. 253-270.

