Reminiszenz und eine Erfahrung im Modus der Bildhaftigkeit
Reminiszenz
Im Herbst 2007 organisierte ich für einen Teil des Lehrkörpers an der Kunsthochschule Luzern eine zweitägige Weiterbildung. Unsere Frage damals war: Wie vermitteln wir in den künstlerischen Ausbildungsgängen Theorie als Pendant oder Bestandteil der Kunst? Worauf zielt unsere Lehre angesichts einer eingesessenen Dichotomie, nämlich jener von Theorie und künstlerischer Praxis, die besonders an Kunsthochschulen wie ein Mantra wiederholt wird und die sich auch in der Struktur der Lehrpläne niederschlägt – hier die Praxismodule, dort die Theoriemodule, hier die Praxisdozierenden, dort die Theoriedozierenden.
Als Vorsteherin der Theorieabteilung und als Dozentin ist das eine für mich fast tägliche Frage. Knüpft man sie (und die Dichotomie, die sie aufwirft) an die kleine Skulptur von Fischli/Weiss aus der Serie „beliebte Gegensätze“, kann darüber ein gutes Lehrgespräch beginnen. Es kommt immer wieder etwas anderes heraus. Da der Gegensatz aber „beliebt“ ist, löst er sich nicht auf dabei. So gibt es grosso modo in diesen Gesprächen über die Skulptur zwei Lager: Die einen halten fest, dass man mit der Theorie kein Haus bauen, dafür aber herausfinden kann, was es für Modelle der Realität gibt und wie Sprache („die Schubkarre“) verkörpert werden kann. Die anderen hingegen konstatieren: Theorie ist ein Unterdrückungsmodell, in dem der eine den andern führt und kontrolliert. Die einen blicken auf den Gegensatz, die anderen nur auf die Figur der Theorie, weil die Praxis (die Schubkarre selbst) zu banal scheint.

Abb. 1: Fischli/Weiss: „Beliebte Gegensätze“, aus der Serie: „Und plötzlich diese Übersicht“ 1981
Es kann deshalb nicht erstaunen, dass der Gegensatz weiterhin besteht und auch immer wieder unüberwindlich scheint – bei aller Einsicht darin, dass Theorie und Kunstpraxis zusammen auf demselben Terrain stehen und erst zusammen das Kunstwerk ausmachen – wie bei Fischli/ Weiss. Der Gegensatz war und ist perpetuell, er gehört irgendwie zu den Paradoxien der Lehre, mit der wir in der Kunstausbildung zu tun haben, mit der wohl alle Kunstpädagogik zu tun hat.[1] Damals – und nun komme ich zu „meiner“ Reminiszenz – hatten sich die Diskussionen diesbezüglich wieder einmal verschärft. Es ging im Zuge der Bologna-Reform um Pensen, um Macht, Einfluss, Verlustangst, neue Bewertungssysteme und Anforderungsprofile. Was, wenn die Theorie wirklich die Kontrolle übernähme, in jedem Modul ein Theoretiker säße? Oder umgekehrt: Was, wenn die Künstler die Regie auch in der Theorie übernähmen, sie, die nicht wissenschaftlich diszipliniert wurden, die nichts auf den Begriff bringen wollen und darauf beharren, dass es Dinge gibt, die nicht analysiert werden dürfen, weil sie einer wilden Intuition folgen? Es musste also jemand von außen geholt werden, der die Gegensätze, wenn nicht versöhnen, so doch verschieben könnte.
Vor-bildern
Karl-Josef Pazzinis Arbeiten waren mir damals schon aufgefallen, ich kannte ihn aber nur indirekt und konnte ihn nun nach Luzern einladen zu einer Weiterbildung, zu welcher sich Theorie- und Praxisdozierende einfanden. Ein Höhepunkt dieser zwei Tage damals war das Lehrbeispiel „Lasso“ von Salla Tykkä, eine Videoarbeit, die Pazzini langsam herangeholt und dann überraschend verbunden hat mit der Frage, was Kunst uns lehrt – als Drittes, zwischen Lehrperson und Studierenden. Vielleicht auch als Drittes jenseits der Dichotomie von Theorie und Praxis.
Der Film handelt von einer Läuferin, einem Haus, einem Fenster, einem Jungen mit Lasso im Innenraum; er handelt von dem, was die beiden trennt.
Im Film ist eine Glasscheibe, die für einige Sinnesqualitäten undurchlässig ist, aber nicht ohne Wirkung bleibt. Gerade wegen der Undurchlässigkeit. (…) Die Glasscheibeist das jeweilige Interface. Die Unmöglichkeit der unvermittelten Teilhabe kann neue Inventionen frei setzen. Gewünscht haben wir uns als Spezialisten fürs Happyend, die wir alle sind, dass die Glasscheibe weg wäre, die Vitrine. Aber dann hätte es den Film nicht gegeben. Nicht einmal eine Kamera, die ja auch vorne ein Glas hat. Wir wären dann immer auf dem kürzesten Weg zum Friedhof unterwegs. (Pazzini 2015: 314)
Was haben wir damals nun mit dem Film gelernt, was behalten? Wie hat Pazzini das Beispiel eigentlich gebraucht? Was ist übriggeblieben? Beim Durchsehen meines Notizbuchs wurde mir klar: Es war gar kein Bei-spiel. Es war das Zentrum von etwas und nicht etwas, dem es zur Illustration bei-gespielt wurde. „Lasso“ diente der Eröffnung eines Denkraums, den wir für den Rest des Tages bewohnt und bespielt haben. Was uns verband dabei, vor jeder artikulierten Erkenntnis war eine Erfahrung im Modus der Bildhaftigkeit, teilbar für die einen wie für die andern. Eine Erkenntnis über Neugier, Eifersucht, Beziehungswunsch, Projektion, Interesse, die nur im Modus der Bildhaftigkeit möglich war. In dem Maße, wie sich die Protagonisten des kurzen Films nicht verbinden konnten, fühlten wir uns verbunden. Ein Akt der Sozialisierung durch Medien: zusammen rätseln, entziffern, verstehen, beeindruckt bleiben. Bildung. Und ein Lehr-Stück, das nicht ohne Wirkung blieb. Damals ist für mich ein Vorbild von Lehre aus und durch Kunst entstanden. Eine der direkten Wirkungen aus der damaligen Weiterbildung wurde beim Feedback von einem der Teilnehmenden so formuliert:
Seine Art der Vermittlung war streckenweise eine sehr große Zumutung. Trotzdem darf man sich nicht der Täuschung hingeben, er würde das Didaktische in der Lehre völlig außer Acht lassen – im Gegenteil. Er selber sagt, dass das Lehren eine Herstellung des sozialen Bandes an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Raum sei. Dieses existiere nicht von selbst. Lehren sei ein Versuch, alle Verkettungen in eine Spur zu bringen. Er spricht in diesem Zusammenhang auch von Intention und Ritualen – er gebraucht eine andere, nicht didaktische Terminologie, um bildungsrelevante Ebenen und Prozeduren zu beschreiben.
Gefallen hat mir seine Art, mit uns über schwer Benennbares, nicht Überprüf- und nicht Beherrschbares zu diskutieren. Dafür hätte ich mir allerdings mehr Zeit gewünscht. Pazzini ist nicht zum Konsumieren …
Nichts zum Konsumieren, nichts für den Ladentisch, eine Bildungserfahrung jenseits der vertrauten didaktischen Begrifflichkeit. Ich würde sie heute auch in Beziehung setzen zum Lehrstück in der Benjamin’schen Lesart von Brecht, welche den Akt der Unterbrechung selbst als Einfallstor für einen anderen Schauplatz bezeichnet hat. Mittel der Unterbrechung sind die Geste und die Zäsur (vgl. Benjamin 1981: 536).
Filmbeispiele im Unterricht unterbrechen den Zusammenhang, zäsurieren das, worüber wir eben gesprochen und argumentiert haben. Es wurde kein Wissen weitergereicht, sondern eine vielfach unterbrochene Szene erzeugt, in welcher sich eine Weise von Erkenntnis einstellte – eine Erfahrung im Modus der Bildhaftigkeit. Allerdings wäre das Bildhafte im erweiterten Sinn zu denken. Schon für Brecht war die Ästhetik des Lehrstücks intermedial und damit auch technisch immer auf der Höhe der Zeit. (vgl. Brecht 1970: insbesondere 23-35)
Wäre es möglich gewesen, hätte Brecht den Film auf der Bühne eingesetzt, um durch die Struktur von bewegten Bildern den Zuschauer und die Zuschauerin so zu involvieren, wie es Unterrichtssituationen mit Filmen heute tun. Doch natürlich kann man Unterricht nicht der Technik überlassen, wie dies heute viele Zentren für digitales Lernen für möglich halten. Es geht auch weniger um eine Verwischung von Klassenraum und Bühne, es geht um Übertragung: Beim Wiederlesen meiner Notizen hat sich mir bestätigt, dass das vor-bildliche Ereignis zu beschreiben vergleichbar wäre mit dem Einbruch des Imaginären in die Lehrsituation.[2] Warum gelang dies mit „Lasso“ – ein Titel, der sich schon wie ein Trick oder Kunststück anhört? Ich würde sagen, es waren drei ästhetische Momente:
Erstens traf unsere Neugier auf die Neugier der Läuferin, die aus ihrem Lauf (Diskurs) daherkommt und Einblick erhalten möchte; die sich ertappt in ihrem Begehren nach dem Anderen, der mehr kann. Sie wünscht sich auf die andere Seite und öffnet damit das Terrain des Imaginären, spiegelt sich ein. Fenster, Spiegel und Kamera überlagern sich in ihrem Gesicht. Die psychoanalytische Filmtheorie ist sich zwar nicht ganz einig, aber einiges spricht dafür, dass im Film kein kategorischer Unterschied zwischen Spiegel und Leinwand zu setzen ist. Zweitens schauen wir zu, wie sich eine Protagonistin in eine Szene einspiegelt – und sind mittendrin im Drama des Imaginären, dem Begehren nach dem andern im Bild, das uns zurückführt zu unserem Narzissmus, dieser schwierigen Sehnsucht nach uns selbst, die sich verbindet mit der Einsicht: Das ist gut gemacht! Drittens: Das Lasso. Der Einsatz des Lassos wurde (auch) zum Spiegel einer Weiterbildungssituation, in welcher wir können oder wissen wollten, was der andere uns vorführt. Dort der Cowboy, hier Pazzini mit seinen Tricks. „Zum Lassowerfen braucht es viel Übung“.[3] Da es nun um die Bildung eines Vorbildes geht, gibt es in dieser Reminiszenz noch etwas, was ich damals verschwieg, aber in meinen Notizen lag es da: Es gab durchaus Teilnehmende an dieser Weiterbildung, die Pazzinis Trick nicht mochten. Sie meldeten sich ab mit Erklärungen wie diesen:
Sorry, aber ich komme mir vor wie in einem Spiel, dessen Regeln ich nicht kenne, ich kann mit diesem Spiel der Unterstellung und Übertragung nichts anfangen. Pazzini ist für mich zu unnahbar. Werde mich morgen anders weiterbilden.
Ich habe damals in der Auswertung diese Kritik wohl ein wenig unterschlagen. Ich wollte, dass ein Vorbild ein Vorbild ist, kein Haar in der Suppe bleibt. Heute scheint der Nachtrag doch erkenntnisreich. Der Weg zum Anderen – über die Medien, durch die Bilder, beinhaltet vielerlei Zäsuren, Spannungen und Widerstände. Lehrmeister oder Cowboy, das Vor-bild ist in dieser Seh- und Lehrerfahrung immer nur vermeintlich durchlässig, die Einblicke bleiben gestreift, gespalten – zwiespältig. Das Kunststück als Lehrstück war in diesem Sinn nicht synthetisierend, aber eben das war seine Sprengkraft und von da aus ging es weiter.
Nach-bildern 1
In einem Seminar zu Film und Traum habe ich den Film von Salla Tykkä selbst verwendet, anwenden ist ja immer ver-wenden. Eine Art Nach-bildung also. Ich konnte mich nicht erinnern, dass Pazzini oder wir über die Musik – Ennio Moricones Lied vom Tod – gesprochen hatten. Nur der etwas erratische Satz klang nach: „Gäbe es kein Interface, dann wären wir immer auf dem kürzesten Weg zum Friedhof unterwegs.“ Jedenfalls schaute ich mir Sergio Leones Once Upon a Time in the West nochmals an, dessen Leitmelodie bei Salla Tykkä die ganze Videosequenz als Tonspur untermalt. Das Lied und die Videoarbeit sind völlig kongruent, mehr noch: Das Lied scheint den ganzen Film zu tragen, das Geschehen aus sich herauszutreiben. Im Film von Sergio Leone erklingt es, als die Eisenbahn fertig gebaut wurde, die Zivilisation in das „Wilde“ eingedrungen und der Traum vom ewigen Aufbruch nach Westen am Ende war – vielleicht auch der Traum vom Filmgenre des Western selbst (vgl. dazu auch Seeßlen 1989: 12). Beim Einspielen der Melodie trennen sich die zwei Hauptfiguren, die Witwe Jill und der Namenlose, die unter anderen Umständen vielleicht ein Paar geworden wären, für immer. Das Ende ihres Traums von Liebe und seines Traums vom freien Wilden Westen wird über- oder unterspielt mit der Melodie des Todes, die von ganz weither kommt, sich dann orchestral steigert, bis sie in den visuellen Raum eingreift und zur selbständigen Erzählung anschwillt. Gilles Deleuze spricht für diese Funktion der Filmmusik von „Bahnungen“: Über alle Hindernisse rivalisiert in dieser Trennungsszene die süßliche Melodie mit der rauen Umgebung des Farmhauses, dringt in den visuellen Raum ein, während die Bilder zur Partitur werden (Deleuze 1991: 301).
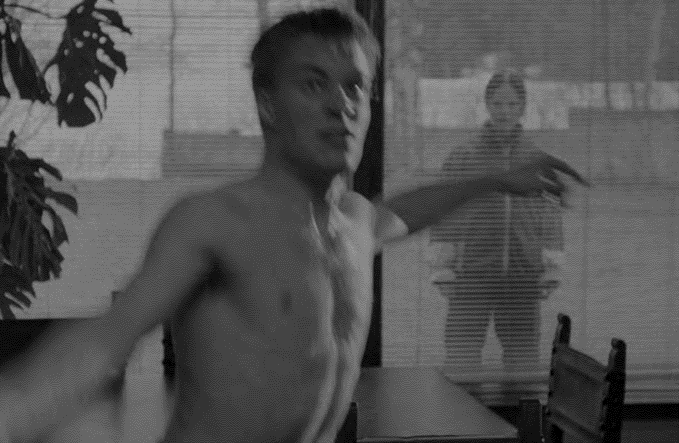
Abb. 2: Videostills aus Salla Tykkä: Lasso (2000). Video, 4 Min.

Abb. 3: Videostills aus Salla Tykkä: Lasso (2000). Video, 4 Min.
Diese Automatisierung der auditiven Sphäre schafft eine eigene Zeitlichkeit – die musikalische Zeit verbindet sich nicht mit dem Filmgeschehen, sondern mit dem Zeiterleben der Figuren (vgl. Piel et al. 2008). Dabei schafft sie für den Zuschauer einen körperlichen Wahrnehmungsraum, der die Sehnsucht nach Übereinstimmung befriedigt, ein Zustand, in dem Trennungen vergessen werden. Die Bilder des Western sind selbst zum Interface geworden, das Unbewusste hat sich dem Schmerz der Trennung, der Enttäuschung über das Ende eines Traums, die mit dem eigentlichen Filmplot vordergründig nichts zu tun hat, angepasst. Man blickt mit Jill in den trostlosen Alltag des Eisenbahnbaus und träumt sich darüber hinweg – wohin? Kann Musik, wenn sie so in den Vordergrund tritt, die Bodenlosigkeit des Imaginären vergessen machen? Führt Musik zu einer glücklichen Gegenübertragung – ist sie das Mittel der Teilhabe? Eine Erfahrung im Modus von auditiver Bildhaftigkeit? Um diese Funktion der Musik bei Salla Tykkä genauer auszuloten, versuchten die Studierenden dann zu „Lasso“ andere Soundtracks zu unterlegen, die eventuell besser passen würden – und merkten dabei, dass sie gar nicht wussten, zu was die Musik denn passen sollte. Genau dies ist das Kunststück bei Salla Tykkä, die Sergio Leone wohl sehr genau studiert hat. Dies führt mich zur Lehre von Pazzini zurück: Damit die Melodie wirkt, die Übertragung stattfindet, dürfen wir nicht sofort wissen, ob sie passt. Darüber entscheidet (wie im Film) das Unbewusste. Das Bewusstsein, die Kontrolle schaltet sich ein, wenn Reibung aufkommt, wenn Melodien nicht passen. Und das geschieht oft genug.
Nach-bildern 2
Jahre später sah ich den Abschlussfilm eines Studierenden, der für mich die Frage von Musik, Bild und Beziehungswunsch neu konfigurierte. In seinem kurzen Dokumentarfilm porträtiert Antonin Wittwer eine Generation, die irgendwo zwischen seinen Eltern und Großeltern liegt: Spät-68er, Aussteiger, Gestrandete, Einsame, deren einzige Heimat das „Schützenhaus“, eine Kneipe in der Zürcher Agglomeration ist. Anders als Andere, so der Titel des Films, haben sie sich allen bürgerlichen Lebensentwürfen entzogen, sind Künstler geworden ohne Job, Reisende, Friseuse ohne Salon, Liebende ohne Ehe und Kinder. Sie haben ihren Traum von Freiheit gelebt, jetzt sind sie alt und auch krank.
Die Schlussszene gehört einem einst anerkannten Fotografen, der in den 80er-Jahren sein florierendes Geschäft freiwillig „an die Wand fuhr“ und mit dem Ziel von Freiheit und Selbstbestimmung nach Westen auswanderte; heute hat der Krebs, und das Schützenhaus ist sein letztes Refugium.

Abb. 4 – 6: Stills aus Antonin Wittwer: Anders als Andere, 2015, Video, 18 Min.
In einem der Gespräche mit Antonin Wittwer geschieht etwas Überraschendes, als der Mann sich und dem Interviewenden sein eigenes „Lied vom Tod“ vorspielt: „If I needed you would you come to me for to ease my pain …“ Der Protagonist fällt aus der Rolle und beginnt zu weinen. Es ist ein seltsames zu-sich-Kommen über die Musik, dem zuerst der Regisseur, die Kamera und nun der Zuschauer beiwohnt. Die Konfrontation mit den eigenen Emotionen („Scheiß-Sentimentalität“ sagt der Mann) führt zu „verdammter Wahrheit“. Mit der alten Schnulze von Don Williams und Emmy Lou Harris kommt die Einsicht, dass es dieses Du nicht gibt, die Suche nach dem Anderen vergeblich war und ist. In Wahrheit kommt niemand für ihn übers Meer geschwommen, weil er auf seiner Reise in die Freiheit vergessen hat, dass es auch Bindung braucht. Das ist nicht gespielt, es ist kleines Kippen aus der Rolle, die auch der Dokumentarfilm für seine Protagonisten bereit hält.[4]
Aus den Medien fallen nicht nur Bilder ins Subjekt ein, sondern eben auch Klänge – als „schwer fassbare Einfälle“ und als direkte Emotion. (Pazzini 2015: 237) Hier setzt der Do- kumentarfilm aber eine klare Differenz: Denn im Gegensatz zur Filmmusik als autonomer Tonspur hat die Musik hier einen bestimmten Ort im Filmset und eine bestimmte Zeit. Sie springt nicht wirklich auf den Zuschauer über, sondern erklingt als Dokument. Damit ist sie, obschon anwesend, weiter weg als die Filmmusik aus dem Off und bleibt letztlich kraftlos. Wäre es anders, könnten wir Dokumentarfilm und Melodrama nicht mehr unterscheiden. Der Dokumentarfilm lebt zwar von der Überschreitung von Kunst und Leben, aber der Fragende, der Neugierige ist mitten drin und muss es aushalten, wenn er zu nahe kommt. Die Kamera stiftet dann keine Distanz mehr, nur der Schnitt. Insofern zeigt auch der Dokumentarfilm immer etwas, was sich nicht sehen lässt und ausgeschnitten bleibt: die Einsamkeit, der Schmerz, das Nicht-Wissen, oder einfach: „die verdammte Wahrheit“. Diese Wahrheit eines Lebens und dessen Scheitern ergibt sich aus Neugier, Zuwendung, dem passenden Einsatz der Medien (das Set, das Objekt, die Stimme, die Musik, die Kamera) und wird dann über „schwer fassbare Einfälle“ teilbar – als Erfahrung im Modus von Bild- und Klanghaftigkeit. Wie in der Psychoanalyse. Wie in der Lehre.
Während wir es aber beim Film mit einem undarstellbaren hors-champs (vgl. Deleuze 1991: 301ff.) zu tun haben, passiert im Unterricht immer wieder eine fixe Rahmung. Entsprechend braucht es eine Haltung. Benjamin hat in Bezug auf Brecht festgehalten, dass es um eine Haltung geht, die darin besteht, sich nichts vorzumachen und durch ästhetische Formen nicht nur zu Erkenntnis, sondern auch zu Emanzipation, Widerstand und Kritik zu kommen (Benjamin 1981: 662).[5] Ich möchte Karl-Josef Pazzini danken dafür, dass er auch in dieser Frage der Haltung immer vorbildlich war.
Anmerkungen
[1] Für einen Teil dieser Konsequenzen Henke 2014: 10ff.
[2] Das große Feld der „ästhetischen Bildung“, das zum einen auf Schiller, zum andern auf Brecht zurückgeht, wurde in jüngster Zeit unter anderem von Spivak als theoretisches und politisches Konzept weiter Vgl. Spivak 2012.
[3] Pazzini (2006). Bei der Bearbeitung des Textes zu „Liebe, Medium, Schnitt“ war dieser einfache Satz plötzlich verschwunden, er fiel wohl einem Schnitt zum Opfer.
[4] Dass der Protagonist diese Szene im Film belassen wollte, spricht für die Kraft von „verdammter Wahrheit“.
[5] Benjamin erkennt diese Haltung bei Herrn Keuner, der späten Brechtfigur, deren Haltung – und das sei kein Zufall – durchaus jesuitische Züge besitze.
Literatur
Benjamin, Walter (1991): Was ist das epische Theater? In: Ders: Gesammelte Schriften, hrsg. R. Tiedemann und H. Schweppenhäuser, Bd. II,2 Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 519-539.
Benjamin, Walter (1991): Bert Brecht. Vorträge und Reden. In: Ders: Gesammelte Schriften, hrsg. v. R. Tiedemann und H. Schweppenhäuser, Bd. II,2 Frankfurt/M.: Suhrkamp, 660-667.
Brecht, Bertold (1970, zuerst 1939): Über experimentelles Theater. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Deleuze, Gilles (1991): Zeit-Bild, Kino II. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Henke, Silvia (2015): Was heißt künstlerisches Denken? [Kunstpädagogische Positionen] Hamburg.
Pazzini, Karl-Josef (2006): Lasso – Was erforscht Kunst? Skizzen einer Antwort aus der Perspektive eines universitären Forscher, Kunstpädagogen, Kunstpädagogen und Psychoanalytikers. In: Buchmann/Lehnhardt/Lingner/Smolik (Hrsg.): Querdurch: Kunst + Wissenschaft. Veranstaltungsreihe der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Hamburg: Materialverlag, S. 136-145.
Pazzini, Karl-Josef (2015): Bildung vor Bildern. Kunst, Pädagogik, Psychoanalyse. Bielefeld: Transcript.
Piel, Victoria/Holtsträter, Knut/Huck, Oliver (2008) (Hrsg.): Filmmusik. Beiträge zu ihrer Theorie und Vermittlung. Hildesheim, Zürich, New York: Olms.
Schiller, Friedrich (2009): Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Seeßlen, Georg (1989): Der romantische Dekonstruktivist. In: Kiefer, Bernd/Grob, Norbert (2003) (Hrsg.): Filmgenres Western. Stuttgart: Philipp Reclam, S. 301.
Spivak, Gayatri Chakravorty (2012): An Aesthetic Education in the Era of Globalization. Cambridge (MA): Harvard University Press.
Abbildungen
Abb. 1: Fischli/Weiss (1981): Beliebte Gegensätze, aus der Serie: Und plötzlich diese Übersicht (Ton, 15 x 10 cm)
Abb. 2 und 3: Stills aus: Salla Tykkä (2000): Lasso. Video, 4 Min. Online: http://www.sallatykka.com/web/index.php?id=34 [19.12.2016].
Abb. 4 – 6: Antonin Wittwer (2015): Anders als Andere. Film 18:54 Min.
Von Silvia Henke
Veröffentlicht am 25. November 2017Zitiervorschlag
Henke, Silvia: Reminiszenz und eine Erfahrung im Modus der Bildhaftigkeit, in: Torsten Meyer, Andrea Sabisch, Ole Wollberg, Manuel Zahn (Hg.): Übertrag. Kunst und Pädagogik im Anschluss an Karl-Josef Pazzini, Zeitschrift Kunst Medien Bildung | zkmb 2017. Quelle: https://zkmb.de/reminiszenz-und-eine-erfahrung-im-modus-der-bildhaftigkeit/; Letzter Zugriff: 04.03.2026Review-Verfahren
Der Text wurde durch zwei Fachgutachter/innen doppelblind hinsichtlich wissenschaftlicher und publizistischer Güte eingeschätzt und ggf. mit Hinweisen zu Überarbeitungsvorschlägen an die/den Autor/in zur Veröffentlichung empfohlen.

